
„Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps“. Die bekannte Redewendung hält uns dazu an, berufliches und privates nach Möglichkeit voneinander zu trennen und hat sich in der Vergangenheit im Wesentlichen bewährt. Unsere Organisationen sind darauf ausgerichtet betriebliches zu fördern und zu entwickeln und privates in einem gewissen Rahmen zwar zu tolerieren, aber im Wesentlichen doch zu unterbinden. Schließlich wird man ja „nicht für sein Privatvergnügen bezahlt“ und eine saubere Trennung hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Seit einiger Zeit diskutieren wir im Unternehmen, wo beim Thema Lernen die Grenze zwischen betrieblichen Bedarfen und privaten Wünschen verläuft. Immer häufiger gibt es Anfragen für Weiterbildungen und Seminare, die sich nicht mehr so eindeutig zuordnen lassen, weil sich ihr Nutzen sowohl betrieblich als auch nicht betrieblich gut argumentieren lässt. So wird auch im Bereich der Weiterbildung die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit immer fließender. Viele Mitarbeitende nutzen betriebliche Möglichkeiten mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, auch um persönliche Interessen zu pflegen und zu entwickeln. Was auf den ersten Blick nach einem einseitigen Ausnutzen klingt, kann auf den zweiten Blick jedoch auch sehr im Sinne des Unternehmens sein, wie folgende Anekdote verdeutlicht:
Vor ziemlich genau 50 Jahren saß Dr. Spencer, ein junger Chemiker, in einem Labor in Minnesota. Er war frustriert über die Ergebnisse seiner letzten Testreihe. Denn das, was eigentlich ein neuer Superkleber werden sollte, ließ sich zwar problemlos auf verschiedene Materialien auftragen, dann aber auch wieder problemlos lösen. Ein Fehlschlag für Spencer. Einige Jahre später unterhielt er sich zufällig mit seinem Arbeitskollegen Art Fry beim Mittagessen über dessen Engagement für den Kirchenchor. Fry ärgerte sich über seine mühsam einsortierten und ständig herausfallenden Lesezeichen in den Gesangsbüchern. Und auf einmal erinnerte sich Spencer an seinen vergangenen Versuch, einen Superkleber zu entwickeln, der sich aber problemlos lösen ließ, und entwickelte zusammen mit Fry ein neues Produkt für sein Unternehmen. Dies war die Geburt des Post-its und der Beginn eines überwältigenden Unternehmenserfolgs für seinen Hersteller 3M.
Wir leben heute mehr denn je in einer Zeit, in der die neue große Idee, der entscheidende Impuls, der ein Unternehmen weiterbringt und vielleicht sogar ganze Branchen revolutioniert, aus jeder Ecke und von jedem Mitarbeitenden kommen kann. Nicht nur aus der Vorstandsetage oder einem strategischen ThinkTank, sondern vom Praktikanten oder einer Kollegin aus einem völlig anderen Bereich und oftmals völlig überraschend. Häufig entstehen solche Ideen durch Zufälle, die im Nachhinein anschauliche Entstehungslegenden abgeben, wie im Beispiel des Post-its. Für Unternehmen, die sich immer häufiger unüberschaubaren, komplexen und asymmetrischen Wettbewerbsverhältnissen ausgesetzt sehen, sind solche quer gedachten Ideen von immer entscheidenderer Bedeutung. Klassische Erfolgsgaranten wie fachliche Expertise oder große Assets rücken zugunsten von einzelnen Ideen und Kreativität in den Hintergrund. Es sind die neuen Ideen und die Menschen die diese mit Leidenschaft verfolgen, die Unternehmen voranbringen und so das Überleben der Firmen in der heutigen Zeit sichern.
Was können wir als Unternehmer tun, um diese Entwicklungen nicht nur dem Zufall zu überlassen? Damit neue Ideen entstehen können, brauchen wir Raum für interdisziplinären Austausch und vernetztes Denken. Jeder soll vom anderen möglichst viel mitbekommen, um so seinen eigenen Horizont erweitern zu können und neue Dinge zu erfahren. Jeder hat andere Interessen und Fähigkeiten und oftmals eine große Bereitschaft diese auch mit anderen zu teilen. Damit dies geschehen kann braucht es einen Ort, an dem viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die ihr Wissen geben und auch Wissen erweitern möchten. Um derartigen Austausch zu begünstigen, müssen Unternehmen Raum schaffen. Einen Raum, in dem sich Menschen mit ihren Sichtweisen und Ideen offen begegnen können. Einen Ort, um Neues zu lernen, um Leidenschaften zu teilen und mit neuen Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu kommen. Um zufälligen und unvorhersehbaren Befruchtungen von Ideen und Gedanken auf die Sprünge zu helfen.
Eine Möglichkeit, so einen Raum zu schaffen, ist die Einrichtung offener Austauschrunden, z. B. durch Impulsvorträge beim gemeinsamen Mittagessen oder gleich der Einrichtung einer offenen Kollegenakademie. So können Mitarbeitende zu Themen, die sie begeistern, Vorträge oder ganze Seminare für ihre Kolleginnen und Kollegen anbieten. Zieht man bezüglich der Inhalte bewusst keine thematische Grenze zwischen betrieblichen und nicht betrieblichen Themen, entsteht ein ganzheitlicher Blick auf die Menschen im Unternehmen. Aufgrund des großen Nutzens und der Möglichkeit zur freien Gestaltung erwarten Mitarbeitende hier keineswegs, dass dies während der Arbeitszeit passieren soll. Sie sind offen und dankbar, dass im Unternehmen Strukturen und Räume zur Verfügung gestellt werden, die einen Austausch und Lernen von privaten Themen ermöglichen. Lebenslanges Lernen nicht nur in der schulischen Form, sondern als Angebot und Chance von Menschen für Menschen.
Auf diese Weise können Unternehmen doppelt profitieren, da der Nutzen für das Unternehmen deutlich über eine stärkere Vernetzung im Sinne der Innovationskraft hinausgeht. Es wird ein Menschenbild gefördert, was Mitarbeitende ganzheitlich sieht, Vielfältigkeit schätzt und jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, seine Persönlichkeit nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln und neue Impulse und Inspirationen für sich zu bekommen. Von der Betrachtung als Mitarbeiter im Unternehmen mit vorrangig betrieblich relevanten Aspekten verändern wir uns zu einer Betrachtung als Mensch im Unternehmen mit allen dazugehörigen Bedürfnissen und Aspekten. Das macht etwas mit den Menschen und ihrer Einstellung zum Unternehmen. Den Kollegen oder die Kollegin mal in einer anderen Rolle zu sehen, andere Kollegen oder Kolleginnen überhaupt in so einem Rahmen kennenzulernen, bietet eine neue Erfahrung und neue Ansatzpunkte in jeder Hinsicht und doch ist es am Ende nicht mehr als ein Raum der Möglichkeiten, in dem persönliche Entwicklung entstehen kann. Ein Angebot zur Weiterentwicklung und vielleicht auch die Saat für die Entstehung innovativer Ideen à la Post-it.
■ Paul Grave
In diesem Herbst veröffentlichte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Diebstahlstatistik des Vorjahres. Insgesamt wurden 2017 in Deutschland rund 28.000 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen. Das sind zwar 5,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Entschädigungssummen sind allerdings deutlich gestiegen (um 8 Prozent).
Autoknackers Lieblinge sind SUVs (Sport Utility Vehicles) und hochwertige Fahrzeuge von Premium-Marken. Spitzenreiter in der „Klauliste“ sind die SUVs Audi Q7 3.0, Mercedes ML 63 AMG und Mazda CX-5. Es folgen der frühere Spitzenreiter Land Rover 3.0 und der Toyota RAV 4 Hybrid.
Solche Fahrzeuge werden eher von gewerblichen als von privaten Kunden gefahren. Und gewerbliche Kunden kaufen häufig nicht, sondern leasen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Unternehmen müssen nicht große Summen für die Fahrzeuganschaffung aufwenden und bleiben so liquide. Außerdem sind die Leasing-Raten als Betriebsausgaben steuerlich voll absetzbar.
Geleaste Autos benötigen einen besonderen Versicherungsschutz. Denn die Kaskoversicherung ersetzt nach einem Diebstahl immer nur den tatsächlichen Fahrzeugwert am Schadentag (Wiederbeschaffungswert). Das reicht aber bei Leasingfahrzeugen in der Regel nicht aus. Denn wenn das Fahrzeug gestohlen wird, rechnet der Leasinggeber den Vertrag ab und stellt dem Kunden den nach dem Leasingvertrag offenen Buchwert in Rechnung. Der ist meist höher als der tatsächliche Wert des Fahrzeugs am Schadentag. Diese Lücke (Englisch: gap) kann der Kunde mit einer im Rahmen der Vollkaskoversicherung angebotenen GAP-Versicherung schließen. In der Regel berechnen die Versicherer dafür einen gesonderten Zusatzbeitrag. Nur bei wenigen Versicherungsunternehmen, ist die GAP-Deckung immer automatisch in der Vollkaskoversicherung mitversichert. Autofahrer, die geleaste Autos nutzen, sollten daher immer prüfen, ob eine GAP Deckung im Leasingvertrag oder ihrem Kfz-Versicherungsvertrag enthalten ist.
Tipp: Nicht nur Autos werden geleast. Auch bei Arbeitsmaschinen, fahrbar oder stationär, besteht die Gefahr, dass im Totalschadenfall der Buchwert höher ist als der Wiederbeschaffungswert. Diese Lücke kann eine Maschinenversicherung schließen.
■ Rainer Rathmer
Im Mai dieses Jahres sorgte Siemens-Chef Joe Kaeser für Aufsehen, als er als erster Chef eines Dax-Konzerns öffentlich auf Konfrontationskurs zur AfD ging. Er kritisierte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel, die zuvor im Bundestag mit einer ausländerfeindlichen, verbalen Entgleisung für einen Eklat gesorgt hatte und twitterte: „Lieber Kopftuch-Mädel als Bund Deutscher Mädel. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Da, wo die Hauptquelle des deutschen Wohlstands liegt.“ Auch OTTO-Chef Alexander Birken äußerte sich nach den Vorfällen in Chemnitz in einem Gastbeitrag in der WirtschaftsWoche: „Unternehmer, erhebt eure Stimme gegen Hass und Gewalt!“. Und Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ernst & Young forderte vor den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen seine deutschlandweit 10.000 Mitarbeiter per Mail auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, „um die demokratischen und rechtsstaatlichen Kräfte in unserem Land zu stärken“. Heute sei unsere liberale Demokratie wieder großen Angriffen von Innen und Außen ausgesetzt.
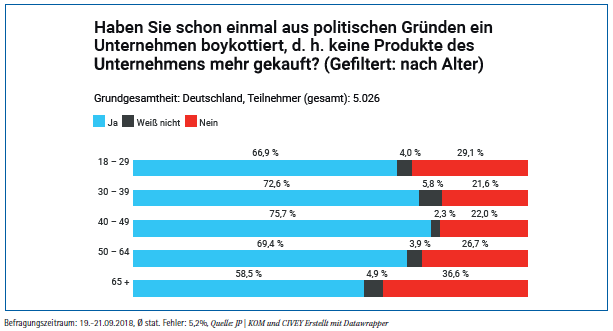
Dabei bestätige uns die ganze Welt, dass unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Internationalität entscheidende Standortvorteile im globalen Wettbewerb seien, schrieb er in seiner Mail. Die AfD nannte er zwar nicht namentlich – der Seitenhieb war dennoch deutlich. Die Liste an Beispielen ließe sich noch um weitere namenhafte und sicherlich auch viele kleine und mittelständische Unternehmer ergänzen und sie zeigt: Es gibt sie, die Firmen bzw. Firmenchefs, die sich als Stellvertreter ihrer Unternehmen klar zu aktuellen politischen Diskussionen positionieren.
Ist Reden Silber und Schweigen Gold?
Der Großteil der deutschen Manager schweigt jedoch lieber, wenn es um Politik oder allgemein polarisierende Themen geht. Das ist nicht verwunderlich, denn es sprechen durchaus gewichtige Argumente für diese Zurückhaltung:
Zunächst einmal muss man mit hoher Gewissheit in Kauf nehmen, vom stillen Beobachter zur Zielscheibe für Anfeindungen zu werden, wie Joe Kaeser es erlebt hat. Der erntete für seine klare Haltung zwar viel Lob, nahm aber auch einen massiven Shitstorm und sogar Gewaltandrohungen gegen ihn und seine Familie in Kauf.
Auch stellt sich in vielen Fällen die Frage des Mandats. Gerade als Chef eines großen Konzerns, der permanent in der Öffentlichkeit steht, lassen sich der Privatmann und die Rolle des Unternehmenslenkers kaum voneinander trennen. Als Privatmann kann man selbstverständlich eine klare politische Haltung formulieren, aber hat man auch ein Mandat für tausende Mitarbeitende und – je nach Rechtsform – für Eigentümer und Aktionäre zu sprechen? Als Chef eines kleinen oder mittleren inhabergeführten Unternehmens besteht zwar erst recht Personalunion zwischen Privat- und Geschäftsmann, aber die Frage des Mandats ist sehr viel einfacher zu beantworten.
Und natürlich besteht auch das wirtschaftliche Risiko von Umsatzeinbußen, weil man davon ausgehen muss, zumindest einen Teil seiner Kunden gegen sich aufzubringen. Eine aktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Kommunikationsagentur JP|KOM zeigt: 67 Prozent der Befragten haben Unternehmen und deren Produkte aus politischen Gründen schon einmal boykottiert.
Nicht mehr ganz aktuell, aber sehr anschaulich für diesen Effekt, ist das Beispiel des Sportartikel-Herstellers Lonsdale. In den 90er-Jahren erfreute sich die Marke im rechtsextremen Milieu großer Beliebtheit – mutmaßlich aufgrund der Buchstabenfolge NSDA im Markennamen. Ende der 90er-Jahre startete Lonsdale daher eine Kampagne gegen Rechts mit dem Slogan „Lonsdale loves all Colors“, überprüfte seine deutschen Vertriebspartner und trennte sich von allen, die im Verdacht standen der rechtsextremen Szene anzugehören. Deutschlandweit gingen die Umsätze damals um 35 Prozent zurück, allein in Sachsen um 70 Prozent. Lonsdale nahm diesen Umsatzeinbruch bewusst in Kauf und engagiert sich auch heute noch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Natürlich lässt sich das Beispiel von Lonsdale schwer übertragen, denn dieses Unternehmen musste sich zu einem Thema positionieren, mit dem es ohne eigenes Zutun in Verbindung gebracht worden war. Lonsdale befand sich nicht in der Rolle des neutralen Beobachters, sondern war gezwungen eine Haltung zum Rechtsextremismus einzunehmen, denn auch ein Nicht-Handeln wäre in diesem Fall eine Haltung gewesen – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
Was erwartet die Bevölkerung von Unternehmen?
Ohne äußeren Zwang aus der Neutralität herauszutreten ist dagegen eine sehr viel schwierigere Entscheidung, zumal in der Civey-Studie 59 Prozent der Befragten angaben, von Unternehmen eher eine neutrale politische Haltung zu erwarten.
Immerhin 31 Prozent der Deutschen wünschten sich jedoch ausdrücklich eine klare Positionierung. Die Befürworter gehörten dabei vermehrt dem eher linken Wählerspektrum an (SPD, Grüne, Linke), während sich im Lager der AfD Wählerschaft rund 80 Prozent für politische Neutralität von Unternehmen aussprachen – und das, obwohl das Recht auf Meinungsfreiheit ansonsten gerade bei der AfD und ihren Anhängen gerne in Anspruch genommen bzw. ausgereizt wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …
40 Prozent insgesamt und 50 Prozent der 30- bis 39-jährigen gaben sogar an, die Produkte eines Unternehmens häufiger zu kaufen, wenn die öffentlich vertretene Unternehmensmeinung mit der eigenen Überzeugung übereinstimme. Laut einer internationalen Studie im Auftrag von Forbes trifft das in der Generation der Millennials sogar auf 73 Prozent zu. Vier von fünf dieser wirtschaftlich immer wichtiger werdenden Generation fordern von Marken, ihre Werte und Haltungen offen zu kommunizieren.
Sich neutral verhalten oder sich klar positionieren?
Für beide Optionen gibt es wirtschaftliche Argumente, so dass diese alleine bei der Entscheidung nicht weiterhelfen. Aber eine Haltung, die man aus wirtschaftlichem Kalkül kommuniziert, oder schlimmer noch, sie aus diesem Kalkül überhaupt erst einnimmt, hat mit Haltung dann auch eigentlich nichts mehr zu tun, sondern ist „Whitewashing“, also reine PR-Strategie. Und davon ist in unserer digitalen Wissensgesellschaft dringend abzuraten, denn sie ist nur allzu leicht zu durchschauen. Haltung darf weder Trend noch Fake sein. Entscheidend ist, dass man danach handelt und für sie einritt – jeder in seinem individuellen Wirkungskreis. Denn die wenigsten Unternehmer twittern so umtriebig wie Joe Kaeser, betreiben einen eigenen Firmenblog oder werden zu politischen Talkshows eingeladen. Aber im direkten persönlichen und beruflichen Umfeld kann, darf und sollte jeder Haltung zeigen – und zwar mit Worten UND Taten.
■ Ruth Snethkamp
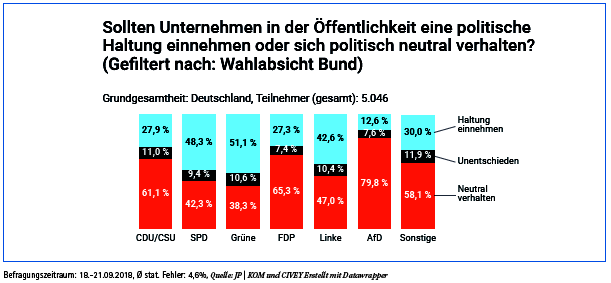
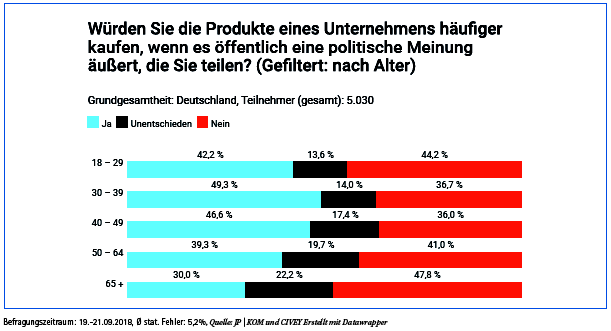
Wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns aus? Fragen wie diese bilden die Grundlage einer jeden Markenbildung. Wie sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dem Thema angenähert hat und inwiefern Markenführung dort als Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen wird, hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei der IGU-Mitgliederversammlung in Münster erläutert.
Man eiferte dem großen Vorbild Manchester United nach: Als der BVB im Herbst 2000 auf dem Börsenparkett auflief, strotzten die Verantwortlichen vor Optimismus. Das Wagnis spülte Geld in die Kassen, die Borussia rüstete ihren Kader kräftig auf, die Meisterschaft 2001/2002 wähnte die Verantwortlichen auf dem richtigen Kurs. Doch dann blieb plötzlich der sportliche Erfolg aus. Ein wirtschaftliches Drama in diversen Akten mündete im Frühling 2005 in ein Sanierungskonzept. Mit Ach und Krach sprangen die Dortmunder der Insolvenz noch einmal gerade von der Schippe.
„Diese alten Fehler“, sagt Carsten Carmer mit Bestimmtheit, „werden wir in Zeiten des Erfolgs nicht noch einmal machen.“ Natürlich gehe es um Wachstum; darum, den Anschluss zu den Großen nicht zu verlieren. Aber nicht mehr um jeden Preis: „Wir fahren nicht im Windschatten der Bayern. Und wir fahren kein Rennen gegen andere. Wir fahren unser Rennen. Und das so schnell wie möglich.“
Das neue Selbstbewusstsein
Selbstbewusst klingt das. Und Cramer ist sich dessen bewusst. „Früher“, sagt er, „hätten wir uns ein solches Selbstbewusstsein gar nicht erlauben können. Denn wir waren uns unserer selbst gar nicht bewusst.“ Wofür steht der BVB überhaupt? Was macht den Verein aus? – Mit Fragen wie diesen hatte sich Anfang des Jahrtausends in Dortmund kaum einer auseinandergesetzt. Sie gerieten allerdings zum Rettungsanker, als der BVB wirtschaftlichen Schiffbruch erlitt und ein Neustart Not tat: „Wir mussten endlich unsere DNA herausarbeiten“, fasst Cramer die damalige Herausforderung zusammen.
Ein Rückbesinnen allein auf die Tradition des Vereins erschien den Verantwortlichen als unzureichend. Heute steht für Cramer fest: „Unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist die „Gelbe Wand“. Der Marketingchef zeigt eine Aufnahme aus dem Signal Iduna Park: 25.000 Fans füllen hier Spiel für Spiel die größte Stehtribüne Europas. „Was diese Anhänger auszeichnet“, sagt Cramer, „sind ihre besonderen Emotionen, ihre Leidenschaft.“
Von der „Gelben Wand“ zur „Echten Liebe“
Was bedeutet der Verein für diese seine Fans? Der BVB hat hieraus seinen Markenkern und seine Kernkompetenzen abgeleitet: „Intensität“ – Borussia Dortmund steht für ein intensives Fußballerlebnis, für maximale Emotionalität. „Echtheit“ – Ist der Verein authentisch, bringen ihm die Fans auch aufrichtige Zuneigung entgegen. „Bindungskraft“ – Der BVB bedeutet für viele seiner Anhänger Heimat und Familie. Und nicht zuletzt: „Ambition“ – Schließlich geht es hier nach wie vor um Fußball, und damit auch um sportlichen Erfolg. Auf den Punkt gebracht: „Echte Liebe“ – so der Claim, den der BVB seit nunmehr einem Jahrzehnt als sein Markenversprechen verwendet. Und um eben diese „echte Liebe“ dreht sich auch das übergeordnete Ziel, das der BVB für sich formuliert hat. Cramer wirft es auf den Bildschirm: „Wir wollen die Marke Borussia Dortmund noch wertvoller machen. Der BVB soll – auch unabhängig von sportlichen Erfolgen – dauerhaft erste Plätze in den Herzen und Köpfen einnehmen. Wir wollen so viele Menschen so intensiv und so individuell wie möglich erreichen.“
Und zwar sowohl vor Ort, als auch in der digitalen Welt, wie Cramer betont: „Wir müssen auf allen Kanälen aktiv sein – und in der digitalen Welt muss es bei uns genau so aussehen wie in der realen Welt.“ Das digitale Streben ist dabei beileibe nicht nur der Internationalisierung geschuldet: „Wir haben aktuell 55.000 Dauerkarten-Besitzer. Aber auch die werden älter …“, erklärt Cramer.
Der Fan als Markenbotschafter
„Maximale Emotion“ als Dreh- und Angelpunkt des Markenkerns – das bedeutet für den BVB nicht nur Chance, sondern auch Risiko. Andere Wirtschaftsunternehmen treibt das Customer-Relationship-Management, kurz: die Kundenpflege, um. In Dortmund hingegen redet man vom „Fan-Relation Management“: „Man muss sich mal vor Augen halten: Unsere Zielgruppe tritt gegen ein Entgelt als Markenbotschafter des BVB auf. Das gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern auch in der gesamten Kommunikation und im Fan Relation-Management zu berücksichtigen“, erläutert der Marketing-Chef. „Denn wen wir in dieser Körperregion berühren“, Cramer legt seine Hand auf die Brust, „den können wir auch schnell verletzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Kommerzialisierung, Internationalisierung, Vertrieb, Marketing: Worte wie diese sollten eher hinter den Kulissen in den Mund genommen werden. „Die wollen die Menschen nicht hören – da gerät man ganz schnell zur persona non grata.“ Zwar sind die Liebe und die Loyalität der Fans aus Cramers Sicht „sehr werthaltig und ein riesiger Pluspunkt“. Sie fordern aber auch ihren Tribut, nämlich „eine Restriktion in der kommerziellen Tätigkeit“.
Eine unbequeme Wahrheit
Die beschriebene Gratwanderung zwischen emotionalem Anspruch und wirtschaftlichen Ambitionen ist indes nicht die einzige Herausforderung, die sich für den BVB im Zuge des Selbstfindungsprozesses herauskristallisiert hat. Denn wer sich hinterfragt, stößt mitunter auch auf unbequeme Wahrheiten: „Wir haben akzeptieren müssen, dass auch das zu Dortmund und damit zu uns gehört“, sagt Cramer mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen vor Ort. Er geht mit der Problematik offen um, spricht sie in seinem Vortrag sogar mehrfach an. Ein wirtschaftlich leistungsstarker Verein müsse auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – „das gehört sich“. Somit begreife es die Borussia als ihre Aufgabe, „Schattenseiten“ wir eben jene vorherrschende Naziproblematik „nicht zu ignorieren und zu kaschieren“.
Die klare Positionierung als Wegweiser
Seine Suche nach sich selbst hat der BVB inzwischen abgeschlossen. Nun gilt es aus Sicht von Carsten Cramer, „die Positionierung immer weiter zu verdichten“. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt: „Man muss sich ab und an die Frage stellen: ‚Wofür stehe ich?‘ Das hilft einem, sich nicht zu verzetteln.“
Zur Person: CARSTEN CRAMER ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und verantwortet dort den Bereich Vertrieb und Marketing. Geboren 1968 in Münster begann er seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer und Marketingleiter bei Preußen Münster, ehe er zum Sportrechtevermarkter Ufa (später Sportfive) wechselte. Als Teamleiter betreute er dort zunächst den HSV, von 2002 bis 2007 dann den BVB. Im Anschluss war Cramer für das deutschlandweite Marketing- und Vertriebsgeschäft von Sportfive (heute Lagardère Sports) zuständig, ehe er 2010 zur Borussia zurückkehrte.
■ Katharina Fiegl
In diesem Herbst veröffentlichte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Diebstahlstatistik des Vorjahres. Insgesamt wurden 2017 in Deutschland rund 28.000 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen. Das sind zwar 5,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Entschädigungssummen sind allerdings deutlich gestiegen (um 8 Prozent).
Autoknackers Lieblinge sind SUVs (Sport Utility Vehicles) und hochwertige Fahrzeuge von Premium-Marken. Spitzenreiter in der „Klauliste“ sind die SUVs Audi Q7 3.0, Mercedes ML 63 AMG und Mazda CX-5. Es folgen der frühere Spitzenreiter Land Rover 3.0 und der Toyota RAV 4 Hybrid.
Solche Fahrzeuge werden eher von gewerblichen als von privaten Kunden gefahren. Und gewerbliche Kunden kaufen häufig nicht, sondern leasen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Unternehmen müssen nicht große Summen für die Fahrzeuganschaffung aufwenden und bleiben so liquide. Außerdem sind die Leasing-Raten als Betriebsausgaben steuerlich voll absetzbar.
Geleaste Autos benötigen einen besonderen Versicherungsschutz. Denn die Kaskoversicherung ersetzt nach einem Diebstahl immer nur den tatsächlichen Fahrzeugwert am Schadentag (Wiederbeschaffungswert). Das reicht aber bei Leasingfahrzeugen in der Regel nicht aus. Denn wenn das Fahrzeug gestohlen wird, rechnet der Leasinggeber den Vertrag ab und stellt dem Kunden den nach dem Leasingvertrag offenen Buchwert in Rechnung. Der ist meist höher als der tatsächliche Wert des Fahrzeugs am Schadentag. Diese Lücke (Englisch: gap) kann der Kunde mit einer im Rahmen der Vollkaskoversicherung angebotenen GAP-Versicherung schließen. In der Regel berechnen die Versicherer dafür einen gesonderten Zusatzbeitrag. Nur bei wenigen Versicherungsunternehmen, ist die GAP-Deckung immer automatisch in der Vollkaskoversicherung mitversichert. Autofahrer, die geleaste Autos nutzen, sollten daher immer prüfen, ob eine GAP Deckung im Leasingvertrag oder ihrem Kfz-Versicherungsvertrag enthalten ist.
Tipp: Nicht nur Autos werden geleast. Auch bei Arbeitsmaschinen, fahrbar oder stationär, besteht die Gefahr, dass im Totalschadenfall der Buchwert höher ist als der Wiederbeschaffungswert. Diese Lücke kann eine Maschinenversicherung schließen.
■ Rainer Rathmer
Ein Umzug ist teuer. Allerdings bietet der Staat an, die Kosten steuerlich geltend zu machen. Dabei gibt es Pauschalen in unterschiedlicher Höhe – für Ledige, Ehepaare und für jedes weitere Haushaltsmitglied.
Wer jobbedingt die Wohnung wechselt hat gute Chancen, dadurch seine Steuern zu reduzieren. Neben Einzelkosten, Fahrtkosten oder Ausgaben für die Spedition ist zusätzlich ein Pauschbetrag für „sonstige Umzugskosten“ abziehbar. Im September 2018 hat das Bundesfinanzministerium aktuelle Umzugspauschalen veröffentlicht, die bereits für Umzüge seit dem 1. März 2018 gelten. Für Ledige wird eine Pauschale von 787 Euro, für Ehepaare ein Betrag von 1573 Euro und für jedes weitere Haushaltsmitglied – etwa bei Kindern – 347 Euro anerkannt.
Benötigen etwaige Kinder Nachhilfeunterricht, weil die neue Schule im Unterrichtsstoff weiter ist oder andere Schwerpunkte setzt, kann man auch diese Kosten geltend machen. Für Umzüge seit dem 1. März 2018 werden Aufwendungen für Nachhilfe für jedes Kind bis zum Höchstbetrag von 1984 Euro berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgte, weil beispielsweise erstmals eine Arbeit aufgenommen oder der Job gewechselt wurde oder sich durch den Umzug die Fahrtzeit zur Arbeit deutlich verkürzt.
Wer aus privaten Gründen Haus oder Wohnung wechselt, kann die Kosten für das Umzugsunternehmen als haushaltsnahe Dienstleistung sowie die von einem Handwerker vorgenommenen Reparaturen als Handwerkerleistungen in der Einkommensteuererklärung ansetzen. Mit Handwerkerleistungen lassen sich bis zu 1200 Euro pro Jahr und Haushalt sparen, für haushaltsnahe Dienstleistungen beträgt die maximale Steuerersparnis sogar bis zu 4000 Euro pro Jahr. Das gilt zum Beispiel auch für die Kosten für Gärtner oder Haushaltshilfen. Selbst die Betreuung von Hund oder Katze im Haus des Steuerpflichtigen gehört zu den haushaltsnahen Dienstleistungen.
Quelle: n-tv.de ,awi/dpa
■ Margarete Lindenblatt
Das neue Jahr kommt ja nicht wirklich plötzlich. Genauso wenig wie wir nicht quasi über Nacht ein Jahr älter werden. Und dennoch: Manche Jahre sind dann einfach so bunt, dass der Mensch denkt: Wie gut, dass ein neues Jahr kommt!
Manches wirkt noch nach und am Horizont tauchen schon neue Ziele oder Ereignisse auf. Also aufräumen, ausruhen und nach vorne schauen. Zeitgleich schleicht sich dann auch gleich so etwas wie eine persönliche Hitliste der guten Vorsätze heran. Sie kennen das? Dann sind Sie damit in bester Gesellschaft!
Und hier sind sie dann: Die bundesweit 10 beliebtesten Vorsätze für das vergangene Jahr sahen wie folgt aus*:
1. Stress vermeiden oder abbauen (59 Prozent)
2. Mehr Zeit für Familie und Freunde (58 Prozent)
3. Mehr bewegen/Sport machen (53 Prozent)
4. Mehr Zeit für sich selbst (48 Prozent)
5. Gesünder ernähren (47 Prozent)
6. Abnehmen (30 Prozent)
7. Sparsamer sein (28 Prozent)
8. Weniger Handy, Computer und Internet (18 Prozent)
9. Weniger fernsehen (15 Prozent)
10. Weniger Alkohol trinken (12 Prozent)
Ergänzend zu den obigen Top Ten gab es auch den folgenden Tipp: Nehmen Sie sich maximal 2 bis 3 Vorsätze vor. Bei mehr Vorsätzen laufen Sie Gefahr, schnell wieder aufzugeben. Und wenn Sie jetzt noch Ihre Vorsätze mit Freunden teilen und gemeinsam angehen, ist die Motivation oft höher.
Wie sehen denn Ihre persönlichen Top Ten für 2019 aus? Falls diese ohnehin eher aus 2-3 Vorsätzen bestehen, haben Sie bereits beste Voraussetzungen für ein gutes Gelingen! Und zudem bleibt auch noch Platz für ein paar gute Wünsche …
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Freunden einen guten Start ins Neue Jahr!
*Quelle: Eine Forsa-Studie im Auftrag der DAK-Krankenkasse mit mehr als 3500 Befragten ermittelte die Vorsätze, die sich die Menschen in Deutschland am meisten vornehmen. In der jährlich bundesweit durchgeführten repräsentativen Bevölkerungsumfrage sind seit Jahren die ersten Plätze gleich belegt. Ob selbst gewählt oder vom Arzt bestimmt: Ein gesünderes Leben spielt bei den meisten eine große Rolle. Das Rauchen aufgeben ist dagegen aus den Top Ten herausgefallen.
■ Karsten van Husen
Vermietet der Steuerpflichtige eine Einliegerwohnung als Homeoffice an seinen Arbeitgeber für dessen betriebliche Zwecke, kann er Werbungskosten nur geltend machen, wenn eine objektbezogene Prognose die erforderliche Überschusserzielungsabsicht belegt, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 17. April 2018 IX R 9/17 entschieden hat.
Nach der BFH-Rechtsprechung wird bei der Vermietung zu gewerblichen Zwecken die Absicht des Steuerpflichtigen, auf Dauer einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben erzielen zu wollen, nicht vermutet. Die zweckentfremdete Vermietung von Wohnraum an den Arbeitgeber zu dessen betrieblichen Zwecken hat der BFH nun erstmals als Vermietung zu gewerblichen Zwecken beurteilt. Er widerspricht insoweit der Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 13. Dezember 2005 IV C 3-S 2253-112/05, BStBl I 2006, 4).
Die Kläger sind Eigentümer eines Gebäudes, das sie im Obergeschoss selbst bewohnen. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Besprechungsraum, Küche und Bad/WC im Erdgeschoss vermieteten sie als Homeoffice des Klägers für 476 Euro monatlich an dessen Arbeitgeber. Der Mietvertrag war zeitlich an den Arbeitsvertrag des Klägers und an die Weisung des Arbeitgebers gebunden, die Tätigkeit in diesen Büroräumen zu betreiben. Die Kläger machten aus der Vermietung einen Werbungskostenüberschuss in Höhe von 29.900 Euro geltend. Enthalten waren hierin Aufwendungen in Höhe von 25.780 Euro für die behindertengerechte Renovierung des Badezimmers mit Dusche und Badewanne. Das Finanzamt ließ die Renovierungskosten nicht zum Abzug zu. Das Finanzgericht (FG) hat der Klage teilweise stattgegeben.
Demgegenüber hob der BFH das Urteil des FG auf und verwies die Sache an das FG zurück. Aufgrund der im Mietvertrag vereinbarten Nutzung handele es sich nicht um die Vermietung von Wohnraum, sondern (zweckentfremdet) um die Vermietung zu gewerblichen Zwecken, da die Räume dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Erfüllung von dessen betrieblichen Zwecken überlassen wurden und der Kläger hinsichtlich der Nutzung dem Weisungsrecht seines Arbeitgebers unterlag. Zu berücksichtigen war dabei auch die Koppelung des Mietvertrages an das Bestehen des Dienstverhältnisses. Das FG muss nun noch feststellen, ob der Kläger einen Gesamtüberschuss erzielen konnte.
Quelle: BFH Pressemitteilung Nr. 43/18 v. 20.8.2018)
■ Margarete Lindenblatt
Noch vor Jahren gänzlich unbekannt, bekommt der Begriff Cyber immer mehr Bedeutung. In den Medien hören wir von Cyberangriffen auf Unternehmen, die großen Schaden anrichten. Aber was ist Cyber bzw. ein Cyberangriff überhaupt? Was bedeutet das konkret für Sie als Unternehmer? Wie können Sie sich als Unternehmer vor den Gefahren aus dem Netz und somit vor Cyberangriffen schützen? Viele Fragen tun sich auf, wenn es um dieses Thema geht.
Cyber oder Cyberangriff – was bedeutet das konkret?
Der Begriff Cyber stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „Steuerung“. Er wurde verwendet, wenn man über die Navigation eines Schiffs sprach.
Heutzutage wird das Wort Cyber häufig in Verbindung mit Cyberangriff verwendet. Unter einem Cyberangriff oder einer Cyberattacke versteht man einen elektronischen Angriff, der über eine Netzwerkverbindung erfolgt. Der Angriff kann sich gegen einzelne Computer oder ganze IT-Systeme richten. Der Angreifer oder Hacker hat zum Ziel, die Sicherheitsbarrieren der IT-Systeme zu knacken, um beispielsweise geheime Daten auszuspähen oder Betriebe ganz lahm zu legen.
Achtung! Jedes mit dem Internet verbundene System – vom Computer bis zur WLAN Glühbirne – kann Ziel einer Cyberattacke werden.
Ein Angriff passiert schneller als man denkt
Tatsächlich registriert der Verfassungsschutz, dass alle 3 Minuten ein Cyberangriff auf eine Firma in Deutschland stattfindet. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind betroffen. Doch warum ist das so? Die Gründe sind eindeutig: Gerade die kleineren bis mittleren Unternehmen halten sich schlicht und einfach für zu klein oder ihre Daten für nicht interessant genug, um angegriffen zu werden. Hinzu kommt, dass vor allem aus zeitlichen oder finanziellen Gründen die IT nicht so gut abgesichert ist.
Es regiert das Prinzip Hoffnung
Mir passiert sowas schon nicht, ich werde doch kein Opfer von Cyberkriminalität. Doch die Realität sieht anders aus! Genau das eben beschriebene Denken spielt den Hackern in die Hände. Experten gehen sogar soweit zu sagen:
ES IST NICHT DIE FRAGE OB, SONDERN WANN EIN UNTERNEHMEN GEHACKT WIRD.
Schon hinter einem seriös wirkenden E-Mail-Anhang, wie z. B. einer Rechnung, kann sich Schad- und Spionagesoftware verbergen, die schnell das gesamte Firmennetzwerk infiziert. Die Folgen sind verheerend, wenn man bedenkt, dass ohne funktionierende IT im schlimmsten Fall der ganze Betrieb still steht oder durch den Angriff auch noch Dritte geschädigt werden. Cyberkriminalität spielt sich zumeist schleichend im Hintergrund ab. Das macht sie so gefährlich und schwer zu bekämpfen.
Ein Beispiel
Ein Mitarbeiter eines Handwerkbetriebs recherchiert auf einer Website, kann jedoch nicht erkennen, dass diese manipuliert ist. Ein Computervirus dringt in das Firmennetzwerk ein und infiziert alle Endgeräte. Sämtliche Kunden- und Termindateien werden zerstört, die Montageteams können nicht ausrücken und mehrere Tage lang keine Aufträge abarbeiten. Zudem werden die Computer der Geschäftspartner via E-Mail infiziert und geschädigt.
Wie können Sie sich als Unternehmer schützen?
Zunächst einmal ist es wichtig, Ihre IT und Ihre Daten zu schützen, z. B. durch regelmäßige Datensicherungen. Um die wirtschaftlichen Folgen eines Cyberangriffs abzufedern und die Betriebsbereitschaft schnell wieder herzustellen, ist eine Cyberversicherung unersetzbar.
Was sichert eine Cyberversicherung ab?
Eine Cyberversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen eines Cyberangriffs, leistet Erste Hilfe, wenn etwas passiert, und enthält in der Regel mehrere Bausteine.
Baustein Service und Kosten – Ihr Sicherheitsplus
Es ist eine Aufgabe für Experten, die Ursachen eines Cyberangriffs herauszufinden und die Schäden schnell zu beseitigen. Dafür leistet Ihnen dieser Baustein wertvolle Unterstützung. Hierüber sind z. B. die Kosten für externe Sachverständige abgedeckt. Nichts ist wichtiger, als die Schadenursache so schnell wie möglich zu ermitteln und zu beseitigen, damit der Betrieb normal weiterlaufen kann. Zusätzlich sind oft auch Benachrichtigungskosten enthalten. Diese Kosten fallen an, wenn datenschutzrechtliche Vorschriften verletzt wurden. In der Regel sind Sie dann dazu verpflichtet, die betroffenen Personen umgehend zu informieren.
Baustein Eigenschäden – Schäden in Ihrem Unternehmen
Verschaffen sich Hacker Zugriff auf Ihre IT, können sie problemlos Daten löschen oder unbrauchbar machen. Das kann z. B. Einsatzpläne betreffen, Liefertermine oder Maschinenprogramme. Die Folge: Ein reibungsloser Betriebsablauf ist nicht mehr möglich, und im schlimmsten Fall kommt der gesamte Betrieb zum Stehen. Die Cyberversicherung ersetzt Ihnen bei Unterbrechung oder Beeinträchtigungen des Betriebs sowohl den entgangenen Gewinn als auch die fortlaufenden Kosten. Ebenso übernimmt die Versicherung die Kosten für die Wiederherstellung der verlorenen Daten und die Entfernung der Schadsoftware.
Baustein Drittschäden – Schäden Ihrer Kunden und anderer Dritter
Hier wird Ihnen Versicherungsschutz bei Datenmissbrauch und dessen Folgen geboten. Es geht speziell um den Drittschaden bei Verletzung der Informationssicherheit. Dies können auch Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht, Namensrecht oder Urheberrecht im Rahmen der elektronischen Kommunikation sein. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftungsfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche sowie die Freistellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
Zum Beispiel können Sie bei unserem Partner, der LVM Versicherung, Ihren Versicherungsbedarf individuell zusammenstellen. Sie können sich entscheiden, ob Sie die „Eigenschäden“ oder die „Drittschäden“ absichern möchten. Optimal geschützt sind Sie, wenn Sie beide Absicherungen wählen! Der Baustein „Service und Kosten“ ist immer inklusive, denn sofortige Hilfe – und zwar Rund um die Uhr – ist bei einem Cybervorfall das Wichtigste überhaupt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps durch einen Cybercheck.
Abrunden können Sie den Schutz noch mit einer Rechtsschutzversicherung. Schäden, die bei Ihren Kunden oder anderen Dritten eingetreten sind, können schnell zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren oder gar Strafverfahren gegen Sie führen. Ein Spezial-Straf-Rechtsschutz hilft mit umfangreichen Leistungen. Gut ist es, wenn darin auch ein Daten-Rechtsschutz für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten nach dem neuen Bundesdatenschutzgesetz oder der Datenschutzgrundverordnung enthalten ist.
UNSERE EMPFEHLUNG
Lassen Sie sich von einem Versicherungsexperten individuell beraten, damit Sie den passenden Cyberschutz für Ihr Unternehmen finden.
Tipp: Für Ihre Sicherheit
• Stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Systeme auf dem aktuellsten Stand sind.
• Ihre IT-Systeme sollten über einen Schutz gegen Schadsoftware verfügen, der automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten wird (z. B. Virenscanner).
• Führen Sie mindestens wöchentlich eine Datensicherung durch.
• Bewahren Sie die Datensicherungsmedien an einem anderen geschützten Ort auf. Dies kann beispielsweise ein Wertschutzschrank in einem anderen Gebäude sein.
• Stellen Sie Mindestanforderungen an die Passwortqualität sämtlicher Mitarbeiter und IT-Systeme. Passwörter sollten mindestens aus 8 Zeichen bestehen.
■ Jutta Hülsmeyer
Wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns aus? Fragen wie diese bilden die Grundlage einer jeden Markenbildung. Wie sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dem Thema angenähert hat und inwiefern Markenführung dort als Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen wird, hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei der IGU-Mitgliederversammlung in Münster erläutert.
Man eiferte dem großen Vorbild Manchester United nach: Als der BVB im Herbst 2000 auf dem Börsenparkett auflief, strotzten die Verantwortlichen vor Optimismus. Das Wagnis spülte Geld in die Kassen, die Borussia rüstete ihren Kader kräftig auf, die Meisterschaft 2001/2002 wähnte die Verantwortlichen auf dem richtigen Kurs. Doch dann blieb plötzlich der sportliche Erfolg aus. Ein wirtschaftliches Drama in diversen Akten mündete im Frühling 2005 in ein Sanierungskonzept. Mit Ach und Krach sprangen die Dortmunder der Insolvenz noch einmal gerade von der Schippe.
„Diese alten Fehler“, sagt Carsten Carmer mit Bestimmtheit, „werden wir in Zeiten des Erfolgs nicht noch einmal machen.“ Natürlich gehe es um Wachstum; darum, den Anschluss zu den Großen nicht zu verlieren. Aber nicht mehr um jeden Preis: „Wir fahren nicht im Windschatten der Bayern. Und wir fahren kein Rennen gegen andere. Wir fahren unser Rennen. Und das so schnell wie möglich.“
Das neue Selbstbewusstsein
Selbstbewusst klingt das. Und Cramer ist sich dessen bewusst. „Früher“, sagt er, „hätten wir uns ein solches Selbstbewusstsein gar nicht erlauben können. Denn wir waren uns unserer selbst gar nicht bewusst.“ Wofür steht der BVB überhaupt? Was macht den Verein aus? – Mit Fragen wie diesen hatte sich Anfang des Jahrtausends in Dortmund kaum einer auseinandergesetzt. Sie gerieten allerdings zum Rettungsanker, als der BVB wirtschaftlichen Schiffbruch erlitt und ein Neustart Not tat: „Wir mussten endlich unsere DNA herausarbeiten“, fasst Cramer die damalige Herausforderung zusammen.
Ein Rückbesinnen allein auf die Tradition des Vereins erschien den Verantwortlichen als unzureichend. Heute steht für Cramer fest: „Unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist die „Gelbe Wand“. Der Marketingchef zeigt eine Aufnahme aus dem Signal Iduna Park: 25.000 Fans füllen hier Spiel für Spiel die größte Stehtribüne Europas. „Was diese Anhänger auszeichnet“, sagt Cramer, „sind ihre besonderen Emotionen, ihre Leidenschaft.“
Von der „Gelben Wand“ zur „Echten Liebe“
Was bedeutet der Verein für diese seine Fans? Der BVB hat hieraus seinen Markenkern und seine Kernkompetenzen abgeleitet: „Intensität“ – Borussia Dortmund steht für ein intensives Fußballerlebnis, für maximale Emotionalität. „Echtheit“ – Ist der Verein authentisch, bringen ihm die Fans auch aufrichtige Zuneigung entgegen. „Bindungskraft“ – Der BVB bedeutet für viele seiner Anhänger Heimat und Familie. Und nicht zuletzt: „Ambition“ – Schließlich geht es hier nach wie vor um Fußball, und damit auch um sportlichen Erfolg. Auf den Punkt gebracht: „Echte Liebe“ – so der Claim, den der BVB seit nunmehr einem Jahrzehnt als sein Markenversprechen verwendet. Und um eben diese „echte Liebe“ dreht sich auch das übergeordnete Ziel, das der BVB für sich formuliert hat. Cramer wirft es auf den Bildschirm: „Wir wollen die Marke Borussia Dortmund noch wertvoller machen. Der BVB soll – auch unabhängig von sportlichen Erfolgen – dauerhaft erste Plätze in den Herzen und Köpfen einnehmen. Wir wollen so viele Menschen so intensiv und so individuell wie möglich erreichen.“
Und zwar sowohl vor Ort, als auch in der digitalen Welt, wie Cramer betont: „Wir müssen auf allen Kanälen aktiv sein – und in der digitalen Welt muss es bei uns genau so aussehen wie in der realen Welt.“ Das digitale Streben ist dabei beileibe nicht nur der Internationalisierung geschuldet: „Wir haben aktuell 55.000 Dauerkarten-Besitzer. Aber auch die werden älter …“, erklärt Cramer.
Der Fan als Markenbotschafter
„Maximale Emotion“ als Dreh- und Angelpunkt des Markenkerns – das bedeutet für den BVB nicht nur Chance, sondern auch Risiko. Andere Wirtschaftsunternehmen treibt das Customer-Relationship-Management, kurz: die Kundenpflege, um. In Dortmund hingegen redet man vom „Fan-Relation Management“: „Man muss sich mal vor Augen halten: Unsere Zielgruppe tritt gegen ein Entgelt als Markenbotschafter des BVB auf. Das gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern auch in der gesamten Kommunikation und im Fan Relation-Management zu berücksichtigen“, erläutert der Marketing-Chef. „Denn wen wir in dieser Körperregion berühren“, Cramer legt seine Hand auf die Brust, „den können wir auch schnell verletzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Kommerzialisierung, Internationalisierung, Vertrieb, Marketing: Worte wie diese sollten eher hinter den Kulissen in den Mund genommen werden. „Die wollen die Menschen nicht hören – da gerät man ganz schnell zur persona non grata.“ Zwar sind die Liebe und die Loyalität der Fans aus Cramers Sicht „sehr werthaltig und ein riesiger Pluspunkt“. Sie fordern aber auch ihren Tribut, nämlich „eine Restriktion in der kommerziellen Tätigkeit“.
Eine unbequeme Wahrheit
Die beschriebene Gratwanderung zwischen emotionalem Anspruch und wirtschaftlichen Ambitionen ist indes nicht die einzige Herausforderung, die sich für den BVB im Zuge des Selbstfindungsprozesses herauskristallisiert hat. Denn wer sich hinterfragt, stößt mitunter auch auf unbequeme Wahrheiten: „Wir haben akzeptieren müssen, dass auch das zu Dortmund und damit zu uns gehört“, sagt Cramer mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen vor Ort. Er geht mit der Problematik offen um, spricht sie in seinem Vortrag sogar mehrfach an. Ein wirtschaftlich leistungsstarker Verein müsse auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – „das gehört sich“. Somit begreife es die Borussia als ihre Aufgabe, „Schattenseiten“ wir eben jene vorherrschende Naziproblematik „nicht zu ignorieren und zu kaschieren“.
Die klare Positionierung als Wegweiser
Seine Suche nach sich selbst hat der BVB inzwischen abgeschlossen. Nun gilt es aus Sicht von Carsten Cramer, „die Positionierung immer weiter zu verdichten“. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt: „Man muss sich ab und an die Frage stellen: ‚Wofür stehe ich?‘ Das hilft einem, sich nicht zu verzetteln.“
Zur Person: CARSTEN CRAMER ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und verantwortet dort den Bereich Vertrieb und Marketing. Geboren 1968 in Münster begann er seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer und Marketingleiter bei Preußen Münster, ehe er zum Sportrechtevermarkter Ufa (später Sportfive) wechselte. Als Teamleiter betreute er dort zunächst den HSV, von 2002 bis 2007 dann den BVB. Im Anschluss war Cramer für das deutschlandweite Marketing- und Vertriebsgeschäft von Sportfive (heute Lagardère Sports) zuständig, ehe er 2010 zur Borussia zurückkehrte.
■ Katharina Fiegl
Entgeltumwandlung wird für Mitarbeiter attraktiver. Ab 2019 regelt das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), dass bei neu vereinbarten bAV Verträgen durch Entgeltumwandlung eingesparte Sozialabgaben zugunsten der Mitarbeiter-Betriebsrenten weiterzugeben sind.
Auf dem Wege einer so genannten Entgeltumwandlung können Mitarbeiter anstatt einer Auszahlung Teile des Gehaltes in eine betriebliche Altersversorgung umwandeln. Auf diese Weise zahlen sie niedrigere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Gleichzeitig sparen auch die Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge ein. Schon heute geben viele Arbeitgeber diese Ersparnis in Form eines Zuschusses zur bAV an ihre Mitarbeiter weiter.
Durch das neue BRSG wird dies bei einigen Durchführungswegen zur Pflicht: Soweit ein Arbeitgeber dank einer Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge spart, ist er künftig dazu verpflichtet, den von ihm ersparten Arbeitgeberanteil in den bAV-Vertrag des Arbeitnehmers einzuzahlen. Ein pauschaler Zuschuss in Höhe von mindestens 15 Prozent ist verpflichtend. Betroffen sind die Durchführungswege Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung.
Diese Regelung gilt für alle Entgeltumwandlungen, die ab 2019 neu abgeschlossen werden.
Für bereits bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen ist der Arbeitgeberzuschuss erst nach einer Übergangsfrist ab dem 1. Januar 2022 verpflichtend.
Die IGU hat zu dieser neuen gesetzlichen Änderung ein Interview mit Peter Bredebusch, Sachverständiger für Versicherungsmathematik in der betrieblichen Altersversorgung, geführt.
IGU: Herr Bredebusch, was raten Sie IGU-Mitgliedern bezüglich der Umsetzung dieser neuen Regelung aus dem BRSG?
Peter Bredebusch: Für Neuverträge ist der Zuschuss verpflichtend ab 2019 zu zahlen. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, empfehle ich eine pauschale Zahlung der Zuschüsse. Wenn von der Entgeltumwandlung Teile des Einkommens oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Rentenversicherung oder der Krankenversicherung liegen, ist die präzise Berechnung des Zuschusses nämlich ziemlich kompliziert und aufwändig. Und die Höhe unterliegt im Laufe des Arbeitslebens auch ständigen Veränderungen.
IGU: Wenn der Arbeitgeber pauschal 15 Prozent weitergibt, bleibt ihm dann noch eine Ersparnis an SV-Beiträgen?
Peter Bredebusch: Ja, bezieht ein Arbeitnehmer ein Gehalt, das unter der Beitragsbemessungsgrenze liegt, so beträgt der Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung derzeit 19,375 Prozent. Dieser wird bei einer Entgeltumwandlung vom Arbeitgeber und in ähnlicher Höhe auch vom Arbeitnehmer eingespart. Gibt der Arbeitgeber davon 15 Prozent als Zuschuss weiter, so verbleibt noch eine Ersparnis von ca. 5 Prozent. Ich rate dazu, auch diese an den Arbeitnehmer weiter zu geben, da die Ersparnis vom Arbeitgeber auch erzielt wird und so die Arbeitnehmer zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung stärker motiviert werden. Ein pauschaler Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 20 Prozent ist angemessen und in der Regel aufwandsneutral.
IGU: Wie ist mit bestehenden Betriebsrenten zu verfahren?
Peter Bredebusch: Grundsätzlich müssen Arbeitgeber hier zwar erst ab dem 1. Januar 2022 Anpassungen vornehmen. Aus Gründen der Gleichbehandlung empfehle ich aber, eine einheitliche Regelung für alle Mitarbeiter zu treffen und auch für bereits bestehende Entgeltumwandlungen den Zuschuss schon ab 2019 zu zahlen.
IGU: Wie kann das in der Praxis umgesetzt werden?
Peter Bredebusch: Zunächst einmal muss der Arbeitgeber klären, welche Verträge erhöht werden können und wo dies ausgeschlossen ist – beispielsweise, weil alte Tarife bereits geschlossen sind und Erhöhungen daher nicht mehr möglich sind. Das ist aber auch kein Problem, denn alternativ kann je nach Beitragshöhe entweder ein neuer Vertrag installiert oder aber eine Umverteilung des bisherigen Beitrages vorgenommen werden. Bei gleichem Gesamtbeitrag wird dann der Entgeltumwandlungsbetrag um die Höhe des Arbeitgeber Zuschusses reduziert.
IGU: Wie soll der Arbeitgeber mit Verträgen verfahren, deren Beitrag schon jetzt die Höchstgrenze der sozialabgabenfreien Einzahlung (4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze = 260 Euro Monatsbeitrag) erreicht?
Peter Bredebusch: Hier sollte die Finanzierung der Betriebsrente in Absprache mit dem Mitarbeiter anders aufgeteilt werden, um den Beitrag nicht zu erhöhen. Der Entgeltumwandlungsbetrag kann dann auch hier um den Arbeitgeber-Zuschuss reduziert werden.
IGU: Muss der Arbeitgeber auch für Lohnbestandteile, die aus vermögenswirksamen Leistungen (VL) umgewandelt werden, Zuschüsse zahlen?
Peter Bredebusch: Ja, denn VL gehören zum Entgelt des Arbeitnehmers, und auch hier werden durch Umwandlung Sozialversicherungsbeiträge eingespart. Also sind auch sie zukünftig bei Umwandlung in eine betriebliche Altersversorgung zuschusspflichtig.
IGU: Wie schnell sollte ein Arbeitgeber auf die neue Gesetzesänderung reagieren?
Peter Bredebusch: Arbeitgeber sollten die Zeit bis 2019 beziehungsweise die Übergangsfrist bis 2022 möglichst frühzeitig dazu nutzen, die betriebliche Altersversorgung im Unternehmen zu prüfen, die bisherigen Vereinbarungen gegebenenfalls zu überarbeiten und für die Zukunft rechtssicher auszugestalten. Bestehende Betriebsvereinbarungen oder Versorgungsordnungen sollten entsprechend angepasst werden.
■ Veronika Behrendt
Wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns aus? Fragen wie diese bilden die Grundlage einer jeden Markenbildung. Wie sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dem Thema angenähert hat und inwiefern Markenführung dort als Bestandteil der Unternehmensstrategie begriffen wird, hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bei der IGU-Mitgliederversammlung in Münster erläutert.
Man eiferte dem großen Vorbild Manchester United nach: Als der BVB im Herbst 2000 auf dem Börsenparkett auflief, strotzten die Verantwortlichen vor Optimismus. Das Wagnis spülte Geld in die Kassen, die Borussia rüstete ihren Kader kräftig auf, die Meisterschaft 2001/2002 wähnte die Verantwortlichen auf dem richtigen Kurs. Doch dann blieb plötzlich der sportliche Erfolg aus. Ein wirtschaftliches Drama in diversen Akten mündete im Frühling 2005 in ein Sanierungskonzept. Mit Ach und Krach sprangen die Dortmunder der Insolvenz noch einmal gerade von der Schippe.
„Diese alten Fehler“, sagt Carsten Carmer mit Bestimmtheit, „werden wir in Zeiten des Erfolgs nicht noch einmal machen.“ Natürlich gehe es um Wachstum; darum, den Anschluss zu den Großen nicht zu verlieren. Aber nicht mehr um jeden Preis: „Wir fahren nicht im Windschatten der Bayern. Und wir fahren kein Rennen gegen andere. Wir fahren unser Rennen. Und das so schnell wie möglich.“
Das neue Selbstbewusstsein
Selbstbewusst klingt das. Und Cramer ist sich dessen bewusst. „Früher“, sagt er, „hätten wir uns ein solches Selbstbewusstsein gar nicht erlauben können. Denn wir waren uns unserer selbst gar nicht bewusst.“ Wofür steht der BVB überhaupt? Was macht den Verein aus? – Mit Fragen wie diesen hatte sich Anfang des Jahrtausends in Dortmund kaum einer auseinandergesetzt. Sie gerieten allerdings zum Rettungsanker, als der BVB wirtschaftlichen Schiffbruch erlitt und ein Neustart Not tat: „Wir mussten endlich unsere DNA herausarbeiten“, fasst Cramer die damalige Herausforderung zusammen.
Ein Rückbesinnen allein auf die Tradition des Vereins erschien den Verantwortlichen als unzureichend. Heute steht für Cramer fest: „Unsere USP, unser Alleinstellungsmerkmal, das ist die „Gelbe Wand“. Der Marketingchef zeigt eine Aufnahme aus dem Signal Iduna Park: 25.000 Fans füllen hier Spiel für Spiel die größte Stehtribüne Europas. „Was diese Anhänger auszeichnet“, sagt Cramer, „sind ihre besonderen Emotionen, ihre Leidenschaft.“
Von der „Gelben Wand“ zur „Echten Liebe“
Was bedeutet der Verein für diese seine Fans? Der BVB hat hieraus seinen Markenkern und seine Kernkompetenzen abgeleitet: „Intensität“ – Borussia Dortmund steht für ein intensives Fußballerlebnis, für maximale Emotionalität. „Echtheit“ – Ist der Verein authentisch, bringen ihm die Fans auch aufrichtige Zuneigung entgegen. „Bindungskraft“ – Der BVB bedeutet für viele seiner Anhänger Heimat und Familie. Und nicht zuletzt: „Ambition“ – Schließlich geht es hier nach wie vor um Fußball, und damit auch um sportlichen Erfolg. Auf den Punkt gebracht: „Echte Liebe“ – so der Claim, den der BVB seit nunmehr einem Jahrzehnt als sein Markenversprechen verwendet. Und um eben diese „echte Liebe“ dreht sich auch das übergeordnete Ziel, das der BVB für sich formuliert hat. Cramer wirft es auf den Bildschirm: „Wir wollen die Marke Borussia Dortmund noch wertvoller machen. Der BVB soll – auch unabhängig von sportlichen Erfolgen – dauerhaft erste Plätze in den Herzen und Köpfen einnehmen. Wir wollen so viele Menschen so intensiv und so individuell wie möglich erreichen.“
Und zwar sowohl vor Ort, als auch in der digitalen Welt, wie Cramer betont: „Wir müssen auf allen Kanälen aktiv sein – und in der digitalen Welt muss es bei uns genau so aussehen wie in der realen Welt.“ Das digitale Streben ist dabei beileibe nicht nur der Internationalisierung geschuldet: „Wir haben aktuell 55.000 Dauerkarten-Besitzer. Aber auch die werden älter …“, erklärt Cramer.
Der Fan als Markenbotschafter
„Maximale Emotion“ als Dreh- und Angelpunkt des Markenkerns – das bedeutet für den BVB nicht nur Chance, sondern auch Risiko. Andere Wirtschaftsunternehmen treibt das Customer-Relationship-Management, kurz: die Kundenpflege, um. In Dortmund hingegen redet man vom „Fan-Relation Management“: „Man muss sich mal vor Augen halten: Unsere Zielgruppe tritt gegen ein Entgelt als Markenbotschafter des BVB auf. Das gilt es nicht nur wertzuschätzen, sondern auch in der gesamten Kommunikation und im Fan Relation-Management zu berücksichtigen“, erläutert der Marketing-Chef. „Denn wen wir in dieser Körperregion berühren“, Cramer legt seine Hand auf die Brust, „den können wir auch schnell verletzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.“ Kommerzialisierung, Internationalisierung, Vertrieb, Marketing: Worte wie diese sollten eher hinter den Kulissen in den Mund genommen werden. „Die wollen die Menschen nicht hören – da gerät man ganz schnell zur persona non grata.“ Zwar sind die Liebe und die Loyalität der Fans aus Cramers Sicht „sehr werthaltig und ein riesiger Pluspunkt“. Sie fordern aber auch ihren Tribut, nämlich „eine Restriktion in der kommerziellen Tätigkeit“.
Eine unbequeme Wahrheit
Die beschriebene Gratwanderung zwischen emotionalem Anspruch und wirtschaftlichen Ambitionen ist indes nicht die einzige Herausforderung, die sich für den BVB im Zuge des Selbstfindungsprozesses herauskristallisiert hat. Denn wer sich hinterfragt, stößt mitunter auch auf unbequeme Wahrheiten: „Wir haben akzeptieren müssen, dass auch das zu Dortmund und damit zu uns gehört“, sagt Cramer mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen vor Ort. Er geht mit der Problematik offen um, spricht sie in seinem Vortrag sogar mehrfach an. Ein wirtschaftlich leistungsstarker Verein müsse auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen – „das gehört sich“. Somit begreife es die Borussia als ihre Aufgabe, „Schattenseiten“ wir eben jene vorherrschende Naziproblematik „nicht zu ignorieren und zu kaschieren“.
Die klare Positionierung als Wegweiser
Seine Suche nach sich selbst hat der BVB inzwischen abgeschlossen. Nun gilt es aus Sicht von Carsten Cramer, „die Positionierung immer weiter zu verdichten“. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt: „Man muss sich ab und an die Frage stellen: ‚Wofür stehe ich?‘ Das hilft einem, sich nicht zu verzetteln.“
Zur Person: CARSTEN CRAMER ist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und verantwortet dort den Bereich Vertrieb und Marketing. Geboren 1968 in Münster begann er seine berufliche Laufbahn als Geschäftsführer und Marketingleiter bei Preußen Münster, ehe er zum Sportrechtevermarkter Ufa (später Sportfive) wechselte. Als Teamleiter betreute er dort zunächst den HSV, von 2002 bis 2007 dann den BVB. Im Anschluss war Cramer für das deutschlandweite Marketing- und Vertriebsgeschäft von Sportfive (heute Lagardère Sports) zuständig, ehe er 2010 zur Borussia zurückkehrte.
■ Katharina Fiegl
Kein Unternehmen gründet sich aus dem Nichts. Neben einer guten Idee braucht es viel Engagement und in den meisten Fällen jede Menge Kapital.
Betriebsgebäude, Einrichtung, Maschinen und Fuhrpark, Waren und Vorräte summieren sich von Anfang an zu erheblichen Werten. Diese Werte gilt es bestmöglich zu bewahren. Durch Schadenprävention, aber auch durch einen optimalen Versicherungsschutz. Was aber meint Ihre Versicherung, wenn Sie von Unterversicherung, Wertermittlung, Versicherungswert, Wertzuschlag, Mark 1914, Dynamik, Vollwert spricht? Hier finden Sie die Erklärungen für ein paar Fachbegriffe:
Die Betriebsinhaltsversicherung für das Inventar und die Betriebsgebäudeversicherung für Gebäude versichern auf den ersten Blick die jeweils bezeichneten Sachen – sie meinen aber das finanzielle Interesse, das der Eigentümer an diesen Sachen hat. Regelmäßig ist das der Neuwert, also der Wert der Sachen im neuwertigen Zustand. Andere Werte, der Zeitwert zum Beispiel, können im Einzelfall vereinbart werden.
Damit von vornherein die richtigen Werte in ausreichendem Maße berücksichtigt werden, gibt es bei Vertragsabschluss standardisierte Wertermittlungen. Sie erfassen den Wert einer Sache oder einer Gruppe von Sachen und bilden so die Grundlage für die Versicherungssumme. Diese sollte immer dem vollen Wert der versicherten Sache entsprechen. Ist die Versicherungssumme niedriger, dann besteht Unterversicherung. Im Schadensfall wird dann die Entschädigung gekürzt.
Alles wird teurer. Gerade bei langfristigen laufenden Verträgen würde bereits die allgemeine Preisentwicklung über die Zeit zu einer erheblichen Abweichung von Versicherungswert zur Versicherungssumme führen. Damit dies nicht geschieht, werden die Versicherungssummen über eine vertraglich vereinbarte Regelung angepasst. Man spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von Dynamik.
Bei der Inhaltsversicherung geschieht dies durch die Summenanpassung. Zu Beginn des Versicherungsjahres erfolgt hierbei die Anpassung der Versicherungssumme im Verhältnis des sich geänderten Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte.
Bei der Gebäudeversicherung gibt es verschiedene Instrumente zur Vermeidung einer Unterversicherung. Die häufigste Form ist die gleitende Neuwertversicherung. Hierbei wird die Versicherungssumme in Preisen des Jahres 1914, dem Wert 1914 in Mark, angegeben. Eine Anpassung an die Baukostenentwicklung erfolgt dann automatisch durch den sich ändernden Anpassungsfaktor. Eine Mitteilung erhalten Sie in Form Ihrer Beitragsrechnung.
Die Alternative zur gleitenden Neuwertversicherung ist die Versicherung mit Wertzuschlag. Die Versicherungssumme setzt sich hier als Grundsumme auf der Preisbasis des Jahres 1980 zuzüglich eines sich verändernden Wertzuschlags zusammen. Der Wertzuschlag berücksichtigt die Preisentwicklung.
Kein Index oder Faktor kann die jeweils individuelle Situation erfassen. Veränderungen im Unternehmen durch Investitionen oder Umstrukturierungen beeinflussen auch immer die vorhandenen Werte. Hier gilt es dann rechtzeitig auch die Versicherungsverträge anzupassen.
■ Karsten Martini
Die Psyche spielt im Berufsleben eine elementare Rolle. Faktoren wie Zeitdruck, die Möglichkeit ohne störende Unterbrechungen arbeiten zu können oder zwischenmenschliche Beziehungen: All diese Rahmenbedingungen können die Gesundheit positiv beeinflussen, aber auch gefährden.
Es gilt daher herauszufinden, welche Rahmenbedingungen das Wohlbefinden stärken und welche es gefährden, um dann darauf aufbauend Handlungsmöglichkeiten ableiten zu können.
Arbeitgeber in der Pflicht
Seit Ende 2013 ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung für alle Unternehmen und Organisationen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Pflicht. Ziel ist es, präventiv Unfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern. Die Beurteilung schließt zudem die menschengerechte Gestaltung von Arbeit ein und trägt dazu bei, die Gesundheit, die Motivation und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Beschäftigte sollen sich mit ihrer Qualifikation und den damit verbundenen Potenzialen und Kompetenzen individuell entfalten können.
Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Um diesen Anspruch zu gewährleisten, bedarf es eines Wissens zur psychischen Belastung und einer guten Vorbereitung, Durchführung und späteren Nachbereitung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Bei der Vorgehensweise der Beurteilung geht es nicht um die Beurteilung der psychischen Gesundheit von Beschäftigten, sondern um das Beleuchten der Arbeitsbedingungen. Die Beurteilung und Gestaltung der Arbeit steht demnach im Mittelpunkt.
Zu dem Merkmal Arbeitsbedingungen gehören folgende Themenbereiche:
◗ Arbeitsinhalte und Arbeitsaufgaben, z. B. Qualifikation, Verantwortung, Handlungsspielräume und emotionale Inanspruchnahme
◗ Arbeitsorganisation, z. B. Arbeitszeit, Arbeitsablauf und Arbeitsintensität, Störungen und Unterbrechungen, sowie Kommunikation und Kooperation
◗ Soziale Beziehungen, z. B. zu den Kolleginnen und Kollegen sowie zu den Vorgesetzten
◗ Arbeitsumgebung, z. B. Faktoren wie Lärm, Ergonomie am Arbeitsplatz oder die Informationsgestaltung
◗ Arbeitsformen, z. B. Telearbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und Ähnliches
Mitarbeiter einbeziehen ist hilfreich
Die Beurteilung kann über schriftliche Befragungen, Beobachtungen, Interviews oder moderierte Workshops durchgeführt werden. Grundlage ist die Basis von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Hinzu kommt, dass Offenheit und Bereitschaft zu vorgeschlagenen Maßnahmen gezeigt wird, sowie Ressourcen für die Umsetzung bereitgestellt werden. Bei der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Gesundheit sollen alle Beschäftigten angesprochen werden.
Die Arbeit gesund zu gestalten, indem mögliche Veränderungsprozesse angetrieben werden, benötigt häufig Zeit und viel Geduld. Jedes Unternehmen ist individuell und hat unterschiedliche Handlungsspielräume. Einmalige Aktionen laufen häufig ins Leere. Vor der Maßnahmenentwicklung sollten Erwartungen geklärt und miteinbezogen werden, um die Bereitschaft zu eröffnen, neue Wege zu gehen.
Umsetzung im Arbeitsalltag
Maßnahmen könnten z. B. eine Entspannungs- oder auch Bewegungspause von 20 Minuten sein. Beschäftigte tanken neue Kraft und Energie und sind u. a. weniger müde. Sportlich engagierte Mitarbeiter können beispielsweise solche Pausen anleiten.
Eine andere Maßnahme ist, die persönliche Arbeitsorganisation umzustellen. Der Tagesablauf könnte ggf. so umgestellt werden, dass Aufgaben, die mehr Konzentration verlangen, zu Uhrzeiten ausgeführt werden, bei denen die Leistungsfähigkeit am größten ist.
Auch eine möglichst große Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist eine sehr effektive Maßnahme.
Eine weitere, sehr simple Maßnahme ist es, Obst und Wasser bereitzustellen, um in gewisser Hinsicht zum Thema Gesundheit beizutragen. Auch mit so kleinen Maßnahmen kann schon eine Wirkung erzielt werden.
Ein gesunder Arbeitsplatz fördert Motivation und Zufriedenheit
Da in unserer heutigen Zeit psychische Belastungen durch verschiedene Faktoren (z. B. wachsende Unsicherheit in einer immer schnelllebigeren, digitalen Gesellschaft) immer mehr zunehmen, ist es von größter Bedeutung die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in Unternehmen durchzuführen.
Die Beurteilung ist nicht nur eine Chance, die stetige Zunahme von Stress und psychischen Erkrankungen zu stoppen und ihr entgegenzuwirken. Im Fokus steht die Zufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Beschäftigten, denn diese ist Grundlage für die Produktivität und sichert somit Arbeitsplätze.
■ Annika Tenfelde
Man muss kein Pechvogel oder Tollpatsch sein, um einen Schaden zu verursachen. Jedem von uns unterlaufen kleine Unaufmerksamkeiten oder Missgeschicke. Dabei gilt grundsätzlich: Wer einen Schaden bei einem Dritten verursacht, haftet dafür mit seinem kompletten heutigen und auch zukünftigen Vermögen. Dabei kann der Schaden mitunter in die Millionen gehen.
Um auch gegen Missgeschicke mit erheblichen finanziellen Auswirkungen abgesichert zu sein, empfiehlt die Verbraucherzentrale eine Versicherungssumme von mindestens 5 Millionen Euro.
In der Betriebshaftpflichtversicherung ist in den meisten Fällen die Privathaftpflicht kostenlos mitversichert. Diese ist ebenso wichtig wie die betriebliche Absicherung.
Was kann Ihnen beispielsweise in Ihrer Freizeit passieren?
Urlaubszeit – die schönste Zeit des Jahres
Sie mieten sich ein Auto und haben dieses falsch betankt? Oder gar den Mietwagen-Schlüssel auf der Wandertour verloren? Damit die Urlaubsstimmung nicht dahingeht, sichern Sie sich am besten gegen solche Schäden ab.
Drohnen, das neue Spielzeug
– und dies nicht nur für Kinder! Im Gegenteil – auch Erwachsene lassen in ihrer Freizeit Drohnen in die Luft steigen. So kann eine private Landschaftsaufnahme aus der Vogelperspektive ungeahnte Folgen haben, wenn die Drohne durch eine Windböe abstürzt und dabei ein in der Nähe stehendes Auto beschädigt.
Ganz schön ärgerlich!
Besonders elektronische Gegenstände verlieren nach dem Kauf in kurzer Zeit erheblich an Wert. So kann im Schadensfall eine große Lücke zwischen der Zahlung des Haftpflichtversicherers und dem tatsächlichen Aufwand zum Neukauf der nicht mehr zu reparierenden Sache entstehen. Gerade bei Schadensfällen im Bekanntenkreis kann das zu unangenehmen Situationen führen.
Abhilfe schafft hierbei die Neuwertentschädigung für irreparabel beschädigte Sachen oder wirtschaftliche Totalschäden. So erhält Ihr Nachbar, dessen Smartphone Ihnen in den Gartenteich gefallen ist, für sein 6 Monate altes Handy den vollen Neuwert von Ihrer Haftpflichtversicherung!
Damit Sie sich um solche Schäden keine Gedanken machen müssen und Ihre Freizeit sorgenfrei genießen können, ist eine gute Absicherung sinnvoll. Unser Partner, die LVM Versicherung, schützt Sie über den Zusatzbaustein „PremiumPlus“ zur Privat-Haftpflicht nicht nur vor obigen Situationen, sondern bietet noch weitere Vorteile wie u. a. die Forderungsausfalldeckung mit Opferschutz.
Forderungsausfall, was ist das?
Stellen Sie sich vor, Sie werden selbst geschädigt. Der Schädiger hat allerdings keine Privat-Haftpflicht und ist mittellos. Von wem bekommen Sie nun den entstandenen Schaden ersetzt? Hier springt die Forderungsausfalldeckung in Ergänzung zu Ihrer Privat-Haftpflicht ein.
Noch mehr Sicherheit als der Einschluss der Forderungsausfalldeckung bietet der Zusatzbaustein Opferschutz. Der „Forderungsausfall mit Opferschutz“ hilft Ihnen, wenn Sie Opfer einer Gewalttat werden, zum Beispiel bei einer Körperverletzung mit bleibenden Folgen.
Zwar stehen Ihnen gegen den Täter Schadenersatzansprüche zu, allerdings besteht in vielen Fällen das Risiko, dass Sie keine Entschädigung von ihm erhalten. Selbst wenn der Schädiger eine Haftpflichtversicherung hat, würde diese wegen Vorsatz nicht leisten. Und ist er dann auch noch mittellos, bekommen Sie von ihm den Schaden nicht ersetzt. Damit Sie in diesen Fällen nicht zum zweiten Mal zum Opfer werden, bieten einige Versicherer den Baustein „Forderungsausfall mit Opferschutz“ an.
Tipp: Wer seine Drohne fliegen möchte, muss einige Vorschriften beachten! So ist an einer Drohne mit einem Abfluggewicht von mehr als 2 kg eine Plakette mit Namen und Adresse des Halters zu befestigen. Außerdem benötigt der Pilot einen „Drohnen-Führerschein“ .
■ Vera Rosendahl
■ Jutta Hülsmeyer
Ein Führungszeugnis dokumentiert, ob jemand in der Vergangenheit wegen schwerer Straftaten verurteilt wurde. Wenn Einträge verjährt sind, werden sie gelöscht – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Vorbestraft oder nicht? Manche Arbeitgeber gehen auf Nummer sicher. Sie verlassen sich nicht nur auf das Wort ihres Mitarbeiters im Vorstellungsgespräch, sondern sie wollen es zusätzlich auch noch schwarz auf weiß wissen – und zwar in Form eines privaten Führungszeugnisses.
Gemeint ist damit ein Auszug aus dem Bundeszentralregister. In dem Dokument listet das Bundesamt für Justiz sämtliche Strafen auf, die Gerichte in Deutschland gegen einen Betroffenen in den vergangenen Jahren verhängt haben. Doch längst nicht alle Vergehen sind im Führungszeugnis nachzulesen und bleiben auch nicht unbedingt für immer und ewig drin.
Umgangssprachlich ist häufig auch von einem „polizeilichen“ Führungszeugnis die Rede. Diese Bezeichnung ist irreführend. Es geht nämlich nicht darum, dass jemand mit einem Führungszeugnis seine bisherigen Kontakte mit der Polizei offenlegt. Vielmehr werden in dem Dokument lediglich schwere Verurteilungen aufgelistet. Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen und Freiheitsstrafen unter drei Monaten finden im Führungszeugnis keine Erwähnung. Nur wer zu höheren Strafen verurteilt wurde, gilt als vorbestraft.
Neben einem privaten gibt es ein erweitertes Führungszeugnis. Dieses informiert über etwaige Sexualdelikte oder Straftaten gegenüber Minderjährigen. Ein solches Dokument kann ein Arbeitgeber von jemand verlangen, der beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten möchte. Für Tätigkeiten in Einrichtungen für pflegebedürftige und behinderte Menschen sowie mit minderjährigen Asylsuchenden ist ein erweitertes Führungszeugnis verpflichtend. Dem Antrag muss eine schriftliche Aufforderung des Arbeitgebers beigefügt werden.
Ein europäisches Führungszeugnis kann ein Arbeitgeber von einem Mitarbeiter einfordern, der aus einem anderen EU-Mitgliedsland kommt. Ein behördliches Führungszeugnis ist nötig, um ein Gewerbe anzumelden. Darin sind Entscheidungen von Ämtern über einen selbst enthalten. Das kann etwa der Widerruf einer Gewerbeerlaubnis oder eines Waffenscheins sein. In einem erweiterten behördlichen Führungszeugnis ist alles aufgeführt, was strafrechtlich von Relevanz sein könnte. Solche Auszüge bekommen allerdings nur Richter und Staatsanwälte zu sehen. Sie informieren sich so beispielsweise, ob ein Angeklagter schon einmal verurteilt wurde.
Ein behördliches Führungszeugnis kann nur ausnahmsweise – etwa in Strafverfahren – von den Behörden selbst beantragt werden. Die Registerbehörde sendet das Führungszeugnis dann direkt der Behörde zu. Die Antragstellenden können jedoch verlangen, dass das Führungszeugnis – falls es Eintragungen enthält – zunächst an ein von ihnen benanntes Amtsgericht gesandt wird. Dort können die Betroffenen dann das Dokument einsehen.
Egal, um welche Art von Führungszeugnis es sich handelt: Was einmal in einem solchen Dokument festgehalten wurde, verjährt mit der Zeit. Einträge werden im Führungszeugnis je nach Schwere der Straftat nach Ablauf von drei, fünf oder zehn Jahren gelöscht. Voraussetzung für die Verjährung: Der Verurteilte darf in dem Zeitraum kein weiteres Mal verurteilt werden. Bekommt jemand für ein Vergehen, das im Führungszeugnis steht, ein weiteres Mal eine Strafe von einem Gericht aufgebrummt, werden auch alte Einträge nicht gelöscht. Sie bleiben so lange stehen, bis auch der neue Eintrag verjährt ist.
Quelle: n-tv.de, S.M., dps
■ Margarete Lindenblatt
Das neue Reiserecht beruht auf der Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie. Innerhalb der EU sollen einheitliche Regeln gelten. Umgesetzt werden die EU Vorgaben in den neu gefassten Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Das neue Recht gilt für Reisen, die seit dem 1. Juli gebucht wurden und bringt viele Neuerungen für den Reisenden sowie für Reiseveranstalter und Reisebüros. Wenn zwei Reiseleistungen (z. B. Flug, Hotel oder Mietwagen) gebündelt werden oder eine solche Reiseleistung bereits im Vorfeld der Reise mit einer touristischen Leistung (Konzertkarte, Ausflug, Wellnessbehandlung u. a.) gebucht wird und diese 25 Prozent des Gesamtwertes der Reise ausmacht, liegt nach dem neuen Recht eine sogenannte Pauschalreise vor. Die Pauschalreise ist gut abgesichert: Bei Mängeln können Reisende ihre Ansprüche wie etwa eine Minderung oder Schadensersatz gegenüber dem Veranstalter geltend machen. Für Individualreisende war die Durchsetzung ihrer Rechte oft weniger einfach. Das neue Reiserecht bringt erweiterte Regeln für Pauschalreisen.
Wer allerdings nur ein Ferienhaus oder eine Wohnung bei einem Reiseveranstalter bucht, genießt – anders als bislang – nicht mehr den umfangreichen Schutz des Pauschalreiserechts. Hier findet das Mietvertragsrecht Anwendung, das dem Reisenden aber weniger Rechte gibt.
Bislang durfte der Reiseveranstalter bei im Voraus gebuchten Reisen bei bestimmten Gründen eine nachträgliche Preiserhöhung bis zu fünf Prozent des Reisepreises fordern, ohne dass dem Reisenden ein kostenfreies Rücktrittsrecht zustand. Erhöhen sich nach Vertragsabschluss zukünftig beispielsweise die Kosten für Treibstoff oder Hafen- und Flughafengebühren, kann der Reiseveranstalter den Reisepreis nun bis zu acht Prozent erhöhen.
Erst wenn es noch teurer wird, kann der Urlauber von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und ohne Stornogebühren von der Reise zurücktreten. Die Preiserhöhung darf nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgen. Hat der Reiseveranstalter sich das Recht zur Preiserhöhung vorbehalten, muss er aber auch eventuelle Preissenkungen an den Kunden weitergeben, sollten sich seine Ausgaben für Treibstoff u. a. reduzieren.
Der Urlauber, der wegen Reisemängeln Ansprüche geltend machen will (Preisminderung, Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude u. a.), musste dies bisher innerhalb von einem Monat nach dem vertraglichen Ende der Reise beim Reiseveranstalter anzeigen. Diese Ausschlussfrist fällt weg. Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre und darf vom Reiseveranstalter auch nicht durch seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verkürzt werden.
Der Begriff der höheren Gewalt findet sich im neuen Reiserecht nicht mehr, dennoch bleibt der Reisende geschützt. Kommt es nach Vertragsabschluss zu einer Gefahrenlage am Urlaubsort oder sind aufgrund äußerer Einflüsse erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten, kann der Reisekunde kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Im Reiserecht wird hierfür zukünftig der Begriff der unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände genutzt. Vor der Reise hat auch der Reiseveranstalter dieses Rücktrittsrecht. Bei einer entsprechenden Situation während der Reise kann der Urlauber die Reise vorzeitig abbrechen. Fallen Mehrkosten aufgrund einer geänderten vertraglich vereinbarten Rückreise (z. B. Flug) an, kann der Reiseveranstalter diese nicht mehr, wie bisher, zur Hälfte dem Kunden auferlegen.
Reiseveranstalter müssen dem Pauschalreisenden bereits vor Buchung der Reise ein Infoblatt überreichen, mit dem der Reisende über seine Rechte und die gesetzlichen Regelungen informiert wird. Befindet sich der Reisende in Schwierigkeiten, muss der Reiseveranstalter ihm außerdem in angemessener Weise Hilfe leisten, indem er zum Beispiel Infos über Gesundheitsdienste, Behörden oder andere Reisemöglichkeiten bereitstellt.
Quelle: RA T. Klingelhöfer
■ Margarete Lindenblatt
Der Sommer hat ja dann doch noch ein Ende gefunden. Ein kurzer Rückblick in Zahlen:
In Deutschland war die Durchschnittstemperatur im Zeitraum April bis Juli mit deutlichem Abstand (3,6 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990) die höchste, die für diese Monate seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen im Jahr 1881 beobachtet wurde. Ebenso stellt der Deutsche Wetterdienst in seinen Auswertungen fest, dass für diesen Zeitraum noch nie ein so großes Niederschlagsdefizit beobachtet wurde (bis 110 mm/m²).
In den europäischen Ländern waren aufgrund der langanhaltenden Trockenheit und Hitze unter anderem historische Ernteeinbußen zu erwarten. Das genaue Ausmaß wird derzeit noch ermittelt.
Wussten Sie, dass es auch schon das Gegenteil gab? Genau, das sogenannte Jahr ohne Sommer.
Als das Jahr ohne Sommer wird das vor allem im Nordosten Amerikas und im Westen und Süden Europas ungewöhnlich kalte Jahr 1816 bezeichnet.
In den Vereinigten Staaten bekam es den Spitznamen „Eighteen hundred and froze to death“, und auch in Deutschland wurde es als das Elendsjahr „Achtzehnhundert und erfroren“ berüchtigt. Als Hauptursache wird heute der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 angesehen, der von Vulkanologen als deutlich stärker eingestuft wird als der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr.
Genau dieses Jahr ohne Sommer führt uns dann auch zum sogenannten Hungerbrot: Als Hungerbrot wird ein in Notzeiten gebackenes Brot bezeichnet. Teils wurde das knappe Mehl gestreckt, teils die Größe des Brotlaibs verringert, so dass man zum früheren Preis eines Brotes nur noch eine Art Semmel erhielt. Am besten ist das Phänomen eben aus dem Jahr ohne Sommer (1816) dokumentiert, aber nicht darauf beschränkt.
Überliefert sind Rezepte und Zutaten von Hungerbroten. Sie enthielten beispielsweise Sägemehl, was den Geschmack wenig beeinträchtigte, aber nur kurzfristig sättigte. In Württemberg verwendete man ausgepresste Leinsamen als Backzutat. Andere experimentierten in der Hungerkrise von 1816/1817 mit Stroh, Moos und Heu. Der Zweck dieser für den Organismus wertlosen Zutaten war, durch Ballaststoffe das Hungergefühl zu beruhigen. Wegen der Beimischung von Fasern (bis zu 25 Prozent) gingen die Brote aber nicht richtig auf, sie waren klein und hart.
Manchmal wurden Hungerbrote als Erinnerung an eine Notzeit aufbewahrt. In der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall steht im Chorraum der sogenannte Erntedankkasten, der vier semmelartige Hungerbrote von 1816 und Ähren der neuen Ernte des Jahres 1817 enthält.
So wird doch auch nach dem Sommer 2018 einmal mehr deutlich, warum es so etwas wie ein Erntedankfest gibt. Denn eine gute Ernte oder günstiges Wetter sind eben überhaupt nicht selbstverständlich.
Und deshalb: Lassen Sie sich Ihr Brot gut schmecken!
■ Karsten van Husen
Jeder wünscht sich ein sorgenfreies Leben im Alter. Aber gerade für Arbeitnehmer mit niedrigeren Einkommen ist es oft schwer, eine verlässliche Altersvorsorge jenseits der staatlichen Rente aufzubauen.
Mit der neuen Förder-Rente können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter dabei effektiv unterstützen. So zeigen sie soziale Verantwortung, binden wertvolle Arbeitskräfte und können somit selbst profitieren.
Die Förder-Rente dient der betrieblichen Altersversorgung für Arbeitnehmer mit einem Bruttogehalt bis zu 2.200 Euro im Monat. Sie ist auch für Minijobber und Teilzeitkräfte interessant. Und die Handhabung ist für Arbeitgeber völlig unkompliziert.
Der Staat erstattet auf Beiträge von 240 Euro bis 480 Euro pro Jahr einen Förderbeitrag von 30 Prozent dieses zusätzlichen Arbeitgeberbeitrages, also 72 Euro bis 144 Euro. Dieser wird mit der abzuführenden Lohnsteuer verrechnet. Den Beitrag können Arbeitgeber zusätzlich als Betriebsausgaben absetzen. Insgesamt übernimmt der Staat dadurch in vielen Fällen ca. die Hälfte des Beitrages.
Die Abwicklung erfolgt ganz einfach über eine Direktversicherung. Andere Verträge der betrieblichen Altersversorgung werden nicht angerechnet. Auch der steuerliche Förderrahmen wird nicht eingeschränkt. Die Sozialabgabenfreiheit gilt insgesamt bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze.
Vorteile für den Arbeitnehmer:
Die Versorgungssituation im Alter wird verbessert. Sie erhalten entweder eine Rente oder eine einmalige Kapitalzahlung.
◗ Mitarbeiter zahlen nichts und haben keinerlei zusätzliche Ausgaben.
◗ Gut zu wissen: Seit 2018 gibt es einen Freibetrag für die Anrechnung auf die Grundsicherung u. a. von betrieblichen Renten. So bleiben ungefähr 200 Euro monatliche Rente anrechnungsfrei.
Tipp: Als Arbeitgeber können Sie mit der neuen Förder-Rente einen Grundbaustein für die Altersversorgung niedrig verdienender Mitarbeiter legen. Möchten Sie darüber hinaus eine Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Vorsorge bieten, empfiehlt sich für alle Mitarbeitergruppen eine Direktversicherung als Entgeltumwandlung. Auch bei unserem Partner LVM Versicherungen wird die Förder-Rente angeboten. Sprechen Sie uns gerne an.
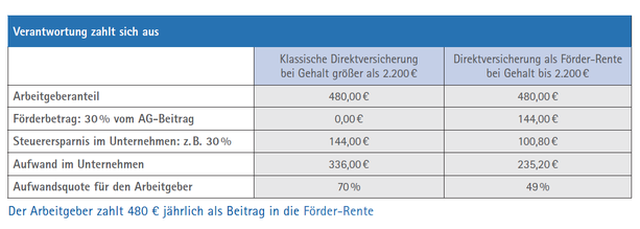
■ Veronika Behrendt
Alles ist so einfach seit WhatsApp. Jeder Kontakt ist unkompliziert erreichbar, Fragen sind schnell beantwortet und an bestimmte Zeiten muss man sich auch nicht mehr halten. Es gibt viele Vorteile, sogar in der Geschäftswelt, vor allem in der Kommunikation mit Kunden! Wenn da nicht das Datenschutzrecht wäre …
Spätestens seit der Veröffentlichung von WhatsApp Business richten immer mehr Gewerbetreibende den „neuen“ digitalen Kontaktweg zum Kunden ein. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Die EU-Datenschutzgrundverordnung zeigt hier klare Grenzen!
Die 5 größten rechtlichen Bedenken und wie man ihnen begegnen könnte:
1. WhatsApp zieht alle auf dem Smartphone gespeicherten Kontaktdaten ab.
Rechtlich gesehen müsste von jedem Kontakt das Einverständnis vorliegen, bevor die Daten an WhatsApp übertragen werden. Doch wer lässt schon alle seine Kontakte vorab unterschreiben? Wer sich vor Strafen schützen möchte, dem bleibt kaum eine andere Wahl: Ein separates Smartphone für WhatsApp, auf dem keine Kontakte eingespeichert sind. Der Nachteil: Man sieht nur noch die Nummern der WhatsApp-Kontakte, keine Namen.
2. Sensible Daten werden auf den Servern von WhatsApp gespeichert.
WhatsApp ist amerikanisch und unternehmerisch verheiratet mit Facebook. Um auf den Datenschutz zu vertrauen, hilft leider auch keine Verschlüsselung. Wer es hier genau nimmt, nutzt WhatsApp nur als reaktiven Kanal und sendet keine sensibleren Informationen. Was Kunden an Daten zur Verfügung stellen, sollte ihnen selbst überlassen sein.
3. Es besteht ein Unterschied zwischen der privaten und gewerblichen Nutzung.
Lange war WhatsApp nicht zur gewerblichen Nutzung erlaubt. Seit der Einführung von WhatsApp Business darf nun auch die Geschäftswelt über den Kanal kommunizieren. Die neue App gibt es derzeit zwar nur für Android, sie bietet aber viele sinnvolle Möglichkeiten: unter anderem automatische Begrüßungsmeldungen und Abwesenheitsnachrichten außerhalb der Geschäftszeiten. Man kann von weiteren Funktionen und vom zukünftigen Ausbau der App ausgehen.
4. Kundendaten müssen manchmal in weiteren Systemen erfasst werden.
Wer bisher Bilder und Dateien aus WhatsApp via Mail an sich selbst gesendet hat um sie von dort in die eigenen IT-Systeme zu bringen, der kann etwas aufatmen. Mit WhatsApp Web wird der eigene WhatsApp-Account im Browser gespiegelt, mit allen Nachrichten. Von hier aus können Dateien lokal gespeichert werden.
5. Nutzer müssen vorab über die Datennutzung informiert werden.
Mit der EU-Datenschutzgrundverordnung gibt es umfassende Informationspflichten zur Nutzung von Daten. Bestenfalls informiert man vor dem Start der WhatsApp-Kommunikation jeden Kontakt über die Risiken der Nutzung. Viele Unternehmen setzen hierfür Disclaimer-Lösungen auf den Internetpräsenzen ein. So bekommen nur die Nutzer die Telefonnummer angezeigt, die aktiv die Kenntnisname der Hinweise bestätigen.
Ist wirklich alles so einfach mit WhatsApp? Wirklich so unkompliziert, schnell und flexibel? In der Geschäftswelt vermutlich nicht. Trotzdem kann es sich lohnen diesen Schritt zu wagen, sich den rechtlichen Bedenken ernsthaft zu stellen und sinnvolle Lösungen zu finden. Am Ende bestimmt der Kunde den Weg und dieser führt wohl zu einer vollumfänglich digitalen Erreichbarkeit – auch über WhatsApp.
■ Anna Juliana Bohr
Seit dem Inkrafttreten am 25. Mai 2018 (IGU berichtete in der Ausgabe 3/2017) ist die Datenschutz-Grundverordnung in aller Munde und beschert Gewerbetreibenden viel Kopfzerbrechen. Welche Regelungen sind zu beachten, wie kann man sich im Fall eines unbeabsichtigten Verstoßes schützen und welche eigenen Rechte hat man?
Hintergrund
Die Datenschutz-Grundverordnung soll den Datenschutz in der EU vereinheitlichen und ins moderne Internetzeitalter befördern. Als EU Verordnung gilt sie unmittelbar für alle Mitgliedsstaaten gleich. Neben der DSGVO ist gleichzeitig das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) in Kraft getreten. Zweck des BDSG-neu ist es unter anderem, Vorgaben zur nationalen Umsetzung der DSGVO zu erfüllen und beispielsweise strafrechtliche Regelungen aufzunehmen.
Inhalte
In 99 Artikeln regelt die DSGVO, wie Unternehmen – aber auch z. B. Behörden und Vereine – mit personenbezogenen Daten umgehen sollen. Viele Unternehmen haben schon reagiert. Offensichtlichste Veränderungen, die in den letzten Monaten Nutzern auf fast jeder Webseite, aber auch im sonstigen Geschäftsalltag begegneten, sind überarbeitete Datenschutzerklärungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Auch die IGU hat in der Ausgabe 2/2018 der „inhalte“ ihre Mitglieder darauf angesprochen.
Kontrolle
In jedem EU-Land sollen unabhängige Aufsichtsbehörden über die Umsetzung der Verordnung wachen. In Deutschland sind das die Datenschutzbehörden der Bundesländer und die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff. Die Aufsichtsbehörden haben das Recht, zum Beispiel von Firmen Informationen einzufordern, die die Kontrolleure für ihre Arbeit benötigen. Dafür dürfen sie auch Ortsbesuche in den Geschäftsräumen machen. Außerdem führen die Behörden Datenschutzüberprüfungen durch.
Sanktionen
Die zuständigen Aufsichtsbehörden können Verwarnungen aussprechen und fordern, dass der Missstand innerhalb einer Frist behoben wird, sie können dafür sorgen, dass personenbezogene Daten eines Nutzers berichtigt, gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt werden. Vor allem können sie auch Bußgelder verhängen, die deutlich höher sind als bei Verstößen gegen das bisherige Bundesdatenschutzgesetz – je nach Schwere des Verstoßes bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des Vorjahresumsatzes. Unter Umständen haften Verantwortliche sogar mit ihrem Privatvermögen – je nach Unternehmensform. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Bußgeldverfahren öffentlich werden und zu Reputationsschäden führen.
Datenschutzverstöße können auch Straftatbestände nach sich ziehen. Diese sind im BDSG-neu geregelt und sehen einen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren vor.
Schadenersatz
Mit Artikel 82 DSGVO wurde eine zentrale Anspruchsgrundlage zum Ersatz materieller und immaterieller Schäden aufgrund Datenschutzverletzungen geschaffen. Durch eine Beweislastumkehr wird die Anspruchsbegründung der Betroffenen erheblich erleichtert und die ersten Klagewellen sind bereits zu verzeichnen. Die Schadenersatzsumme ist in der Höhe nicht begrenzt. Zur Bestimmung des materiellen Schadens ist unter Berücksichtigung der EuGH Rechtsprechung eine weite Auslegung zu erwarten. Die Höhe des Schmerzensgeldes wird sich dann wohl – ähnlich der amerikanischen Rechtsprechung – an der Genugtuungs- und Abschreckungsfunktion und nicht an der in der Regel wesentlich günstigeren Ausgleichsfunktion orientieren.
Rechtsschutzversicherung
Wenn aufgrund eines Verstoßes gegen die DSGVO oder gegen das BDSG-neu gegen einen Gewerbetreibenden ein Ordnungswidrigkeiten- oder gar Strafverfahren eingeleitet wird, kann er gelassen bleiben, sofern er eine gute Rechtsschutzversicherung hat. Diese übernimmt das Prozessrisiko. Im Einzelnen:
In den gängigen Rechtsschutzversicherungen ist der Ordnungswidrigkeiten Rechtsschutz im selbstständigen Bereich enthalten. Bessere Rechtsschutzversicherungen bieten hierfür im Rahmen eines Spezial-Strafrechtsschutzes einen wesentlich weitergehenden Rechtsschutz, z. B. wenn der mandatierte Rechtsanwalt über das gesetzliche Honorar hinaus eine Honorarvereinbarung verlangt oder gar eine Straftat nach dem BDSG-neu vorgeworfen wird. Mit einem Daten-Rechtsschutz ist auch die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener auf Auskunft, Sperrung oder Löschung nach der DSGVO bzw. dem BDSG-neu versichert.
Geht es um die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzansprüchen im gewerblichen oder privaten Bereich, weil ein Dritter gegen die Vorschriften des DSGVO bzw. des BDSG-neu verstoßen hat, besteht über den Schadenersatz-Rechtsschutz Deckung.
Tipp: LVM-Rechtsschutz stärkt seinen Gewerbekunden mit dem Gewerbe-Kombi Rechtsschutz den Rücken mit einem umfassenden Paket – auch im Hinblick auf die DSGVO und das BDSG-neu. Von Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz über Spezial-Straf-Rechtsschutz bis hin zum Daten-Rechtsschutz sind alle wichtigen Leistungen enthalten. Das gilt natürlich auch für den Schadenersatz-Rechtsschutz. LVM-Rechtsschutz bietet seinen Versicherten darüber hinaus hilfreiche Services: Mit einer anwaltlichen E-Mail-Beratung kann z. B. die firmeneigene Webseite datenschutzrechtlich gecheckt werden. Eine einzigartige Dienstleistung wird mit dem Service-Partner „Dein guter Ruf“ geboten: Dieser sorgt dafür, dass rufschädigende Einträge im Internet, die das Persönlichkeitsrecht verletzen, gelöscht werden.
■ Anne Hilchenbach
Das GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) sieht die paritätische Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge ab 1. Januar 2019 vor. Um die Arbeitnehmer zu entlasten, wird der von den Krankenkassen zu erhebende Zusatzbeitrag künftig zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gezahlt.
Seit 2015 setzt sich der Krankenkassenbeitrag aus einem einheitlichen allgemeinen Beitragssatz und einem Zusatzbeitrag zusammen. Der allgemeine Beitragssatz beträgt 14,6 Prozent und wird bei versicherungspflichtigen Arbeitnehmern jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert. Den Zusatzbeitrag hingegen bestimmt jede Krankenkasse selbst. Dieser wurde bisher allein vom Arbeitnehmer gezahlt. Das ändert sich nun, denn ab 1. Januar 2019 tragen auch die Arbeitgeber den halben Anteil des Zusatzbeitrages. Folglich profitiert zukünftig nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber davon, wenn sich der Beschäftigte für die hkk entscheidet.
Ein Rechenbeispiel für die Arbeitgeberersparnis:
Mit der hkk kann ein Betrieb bei Anwendung der aktuell geltenden Zusatzbeitragssätze mit einer jährlichen Lohnsumme von 100.000 Euro gegenüber einer Krankenkasse mit einem Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent* 455 Euro pro Jahr sparen. Bei einer jährlichen Lohnsumme von 250.000 Euro würde bei gleichem Rechenmodell die Beitragsersparnis sogar 1.137,50 Euro pro Jahr betragen.
Beitragsentlastung freiwillig versicherter Selbstständiger
Neben der paritätischen Finanzierung des Zusatzbeitragssatzes wird im GKV VEG auch die Entlastung der freiwillig versicherten hauptberuflich Selbstständigen geregelt.
In der Gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt die Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Der Beitragsbemessung bei den Selbstständigen liegen die Einnahmen anhand der allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts zugrunde. Besondere Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen dienen bereits der Beitragsgerechtigkeit gegenüber den Arbeitnehmern.
Nach der bisherigen Rechtslage erfolgt die Beitragsbemessung für freiwillig versicherte hauptberuflich Selbstständige mindestens auf der Grundlage eines Einkommens in Höhe von 2.283,75 Euro monatlich (kalendertäglich der 40. Teil der monatlichen Bezugsgröße).
Ab 1. Januar 2019 gilt die allgemeine Mindestbemessungsgrundlage in Höhe von 1.038,33 Euro (kalendertäglich der 90. Teil der monatlichen Bezugsgröße). Diese ist auch für Existenzgründer und in sozialen Härtefällen maßgeblich. Damit werden die freiwillig versicherten hauptberuflich Selbstständigen in Bezug auf ihre Mindestbeiträge den übrigen freiwillig Versicherten gleichgestellt und erheblich entlastet.
Die Vorteile der hkk, die zum Verband der Ersatzkassen (vdek) gehört, gelten auch für Selbstständige. Auch sie profitieren vom niedrigen Zusatzbeitrag der hkk.
Über die hkk Handelskrankenkasse
Ihr stabiler Zusatzbeitrag von 0,59 Prozent (Gesamtbeitrag 15,19 Prozent) macht sie seit Jahren zur günstigsten deutschlandweit wählbaren Krankenkasse. Auch die Extraleistungen übertreffen den Branchendurchschnitt: Unter anderem erstattet die hkk zusätzliche Leistungen in den Bereichen Naturmedizin, Vorsorge und bei Schwangerschaft. Ergänzend fördert das hkk-Bonusprogramm Gesundheitsaktivitäten. Aktuell zählt die hkk mehr als 600.000 Versicherte – davon sind über 460.000 beitragszahlende Mitglieder. Die Verwaltungskosten der hkk liegen etwa 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Über 1.000 Mitarbeiter(innen) betreuen ein Ausgabenvolumen (Kranken- und Pflegeversicherung) von mehr als 2 Mrd. Euro. Seit Juli 2009 kooperieren die LVM Versicherung und die hkk Handelskrankenkasse erfolgreich miteinander. Dank der Kooperation profitieren bereits viele hkk Kunden von den Zusatzprodukten der LVM Krankenversicherungs-AG zu attraktiven Sonderkonditionen.
Am Umlageverfahren müssen Arbeitgeber teilnehmen, die in der Regel nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigen. Auszubildende zählen hier nicht mit. Aufgrund der Komplexität der verschiedenen Umlagesätze der Gesetzlichen Krankenkassen, können diese nicht einzeln aufgeführt werden und sind den jeweiligen Websites zu entnehmen.
*der Beitragsvorteil zur hkk (0,59 Prozent) beträgt insgesamt 0,91 Prozent: jeweils 0,455 Prozent Arbeitnehmer-/Arbeitgeberanteil.
■ Sabine Bialek
Wer heute wegen eines Rechtsstreits vor Gericht ziehen will, muss mit hohen Anwalts- und Gerichtskosten rechnen. Nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) stiegen die durchschnittlichen Ausgaben für Anwälte und Gerichte von 2012 bis 2016 um 19 Prozent. Basis der GDV-Analyse sind rund 1,4 Millionen Streitfälle pro Jahr in der Rechtsschutzversicherung. Sie bilden vornehmlich alltägliche Rechtsstreitigkeiten ab, die jedermann treffen können.
Aktuell kann nach GDV-Berechnungen etwa der Kündigungsschutzprozess eines Durchschnittsverdieners deutlich über 3.000 Euro kosten oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Punkt in Flensburg immerhin schon fast 900 Euro. Wer den Kaufvertrag eines Mittelklasse-Neuwagens wegen Mängeln rückabwickeln will, muss im Fall einer Niederlage vor Gericht mit Kosten von über 8.000 Euro rechnen. Die höchste Kostensteigerung von über 200 Prozent haben Miet- und Pachtminderungsstreitigkeiten entwickelt. Dafür ist neben den gestiegenen Prozeßkosten eine geänderte Rechtsprechung zur Errechnung des Streitwertes verantwortlich.
Gute Gründe für guten Rechtsschutz
Eine Klage mit einem Streitwert von 10.000 Euro kostet bis zum erstinstanzlichen Urteil über 4.500 Euro – davon sind rund 700 Euro Gerichtskosten und rund 3.800 Euro Anwaltsgebühren. Die im Prozess unterlegene Partei muss sowohl die Gerichtskosten als auch die Gebühren für den eigenen und den gegnerischen Anwalt übernehmen. Selbst wenn man die Klage gewinnt, ist man vor Kosten nicht gefeit. Im Arbeitsrecht z. B. trägt jeder seine erstinstanzlichen Kosten – egal, wie der Rechtsstreit ausgeht. Und ist der Gegner insolvent, bleibt man ebenfalls auf seinen Kosten sitzen.
Wer nicht aus Kostengründen auf sein Recht verzichten will, dem hilft eine Rechtsschutzversicherung. Schon jetzt übernehmen für mehr als die Hälfte aller Haushalte in Deutschland Rechtsschutzversicherungen das Kostenrisiko möglicher Rechtsstreitigkeiten. Im Jahr 2016 wendeten die Rechtsschutzversicherer für 4,2 Millionen Streitfälle rund 2,8 Milliarden Euro auf. Rund 85 Prozent der Zahlungen waren Anwaltshonorare.
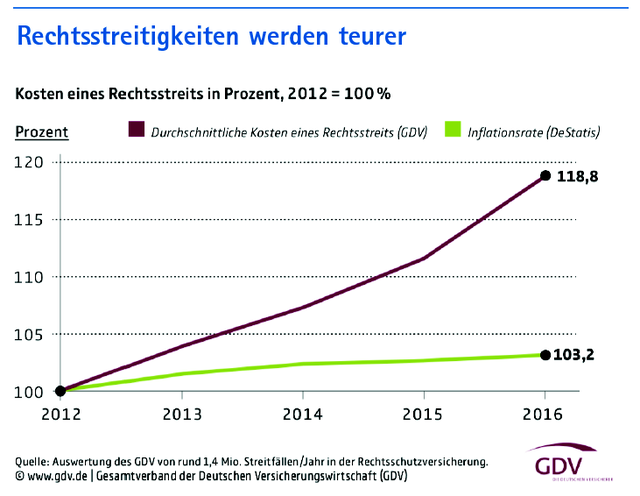
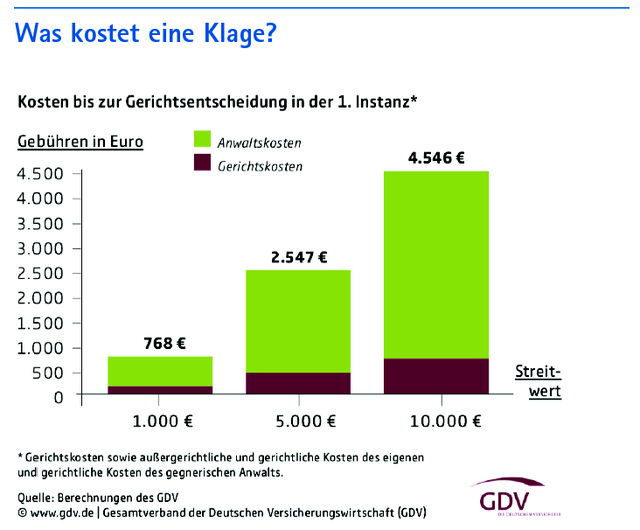
Quelle: https://www.gdv.de/de/themen/news/recht-bekommen-wird-teurer-33148
■ Anne Hilchenbach
In der Medien-Landschaft kursieren vielfältige Berichte und Stellungnahmen zur demografischen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland: zum Teil sehr interessante und lesenswerte Artikel, zum Teil aber auch – nicht immer fachlich fundierte – Horror-Szenarien wie z. B. „Heute sorgen drei Arbeitnehmer für einen Rentner. In Zukunft muss ein Arbeitnehmer für mehr als einen Rentner sorgen.“
Also höchste Zeit für einen Klartext auf der Basis von Zahlen des Statischen Bundesamtes.
Für die nachfolgenden Tabellen wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:
◗ Geburtenrate 1,4 Kinder je Frau
◗ Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2060: für Jungen 84,8 Jahre und für Mädchen 88,8 Jahre
◗ Netto-Zuwanderung pro Jahr: 100.000 Personen (Zuwanderung minus Auswanderung).
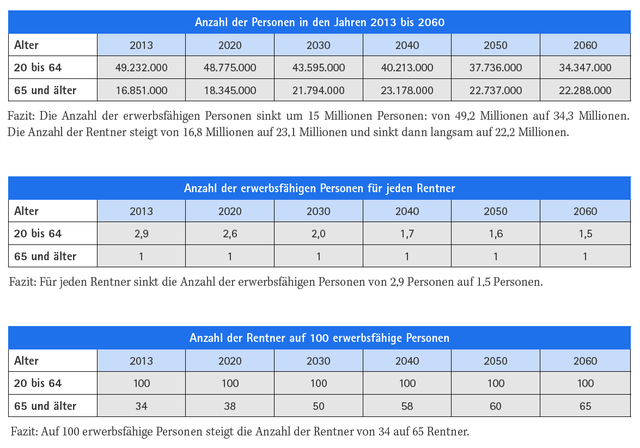
Diese demografische Entwicklung ist im Wesentlichen vorgezeichnet. Größere Änderungen können sich in erster Linie durch die Anzahl der Zuwanderungen ergeben. Je höher die Zuwanderung ist, umso besser ist das Verhältnis erwerbsfähige Personen zu Rentnern. Damit alle profitieren können, setzt dies aber voraus, dass die zugewanderten Personen integriert werden und auch in „Lohn und Arbeit“ gebracht werden können.
Die Herausforderungen für die sozialen Sicherungssysteme sind enorm, insbesondere für die Altersversorgung, aber auch für die Gesundheitsversorgung und für die Pflege.
Kommentar
◗ Im Jahr 1957 hat die Politik einen schweren Fehler begangen, indem sie die kapitalgedeckte gesetzliche Rentenversicherung („Spartopf für’s Alter“) nach fast 70 Jahren seit Einführung durch Bismarck abgeschafft hat und komplett in ein Umlagesystem geändert hat („Junge zahlen für Alte“).
◗ Nach 45 Jahren wurde im Jahr 2002 dieser Fehler politisch korrigiert. Die Riester-Rente wurde eingeführt: eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung. Die Rente aus dem gesetzlichen Umlagesystem wurde moderat gesenkt. Dieser Schritt war richtungsweisend, notwendig und richtig. Auch wenn einige Details (z. B. Transparenz und Verwaltungsreduzierung) natürlich noch verbessert werden können und sollten. Aber: Die grundsätzliche Ausrichtung stimmt.
◗ In den letzten 10 bis 12 Jahren verharrt die Politik leider „im Nichtstun“, wenn es um die Analyse der Altersversorgung ab dem Jahr 2030 und um die zwingend notwendigen Weichenstellungen geht. Es besteht bedauerlicherweise eine „politische Dauer-Starre“.
◗ Es bleibt die Hoffnung, dass die nächsten 12 Jahre (von 2018 bis 2030) genutzt werden, um die gesetzliche Rentenversicherung ab 2030 politisch „systemfest“ zu machen. Für jedes weitere Jahr „Nichtstun“ werden ansonsten die finanziellen Einschnitte ab 2030 umso größer werden.
Lösungsansätze
Auch wenn die Politik momentan in ihren Handlungsmöglichkeiten leider noch zurückbleibt, so gilt doch für die allermeisten Bürger:
Viele Bürger können für sich privat mit einem „Spartopf“ vorsorgen. Einige Grundsätze dafür sind:
◗ Kapitalgedecktes Produkt (Ansammeln von Sparkapital)
◗ Lebenslange Rentenzahlung
◗ Wahl eines seriösen Finanz-Anbieters
Wenn diese Grundsätze beachtet werden, kann der einzelne nicht allzu viel falsch machen!
■ Ludger Overmann
Allein ein Drittel aller Einbruchsversuche scheitert, wenn Wohnungen oder Häuser schwerer zu knacken sind. Dabei sind nicht immer teure technische Systeme wie Alarmanlagen notwendig. Zum Teil werden die Investitionen, die die Sicherheit der Immobilie erhöhen, sogar vom Staat bezuschusst.
Darüber hinaus lässt sich der professionelle Einbau von Alarmanlagen, Spezialfenstern, Bewegungsmeldern und anderen Sicherheitsmaßnahmen steuerlich als Handwerkerleistungen im Haushalt absetzen.
Privatpersonen, die beim selbst genutzten Haus oder der selbst genutzten Wohnung auf Einbruchschutz setzen und dafür einen Profi-Handwerker engagieren, können anfallende Kosten in der Regel teilweise steuerlich geltend machen. Folgende Bedingungen sind dabei zu beachten:
◗ 20 Prozent der jeweiligen Anfahrts-, Arbeits-, Maschinen-, Entsorgungs- und Verbrauchsmittelkosten (zum Beispiel Aufwendungen für Reinigungsmittel) lassen sich laut Steuerexperten der Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) absetzen.
◗ Jährlich können maximal 1.200 Euro (20 Prozent von maximal 6.000 Euro) als Handwerkerleistungen geltend gemacht werden.
◗ Materialkosten finden keine Berücksichtigung, deshalb sollten in der Rechnung die verschiedenen Kostenarten unbedingt getrennt ausgewiesen werden.
◗ Als Belege kann das Finanzamt die Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung sowie einen geeigneten Nachweis über die Begleichung der Summe verlangen. Wichtig dabei ist, dass der Rechnungsbetrag immer überwiesen wurde. Barzahlungen gegen Quittung akzeptiert das Finanzamt nicht.
Der Fiskus bietet in Sachen Einbruchschutz verschiedene Fördermöglichkeiten an. Wer Zuschüsse oder Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch nimmt, kann die dabei erbrachten Handwerkerleistungen nicht mehr steuerlich geltend machen. Durch diese Regelung will der Staat eine Doppelförderung – also sowohl über die KfW als auch über die Steuerermäßigung – ausschließen.
Auch durch Einbruchschäden verursachte Kosten sind nicht absetzbar. Hier ist dann vor allem die Hausratversicherung gefragt. Ausnahme: Wenn sich im Privathaushalt ein beruflich genutztes Arbeitszimmer befindet, kann man dem VLH zufolge die Ausgaben für die Hausratversicherung unter Umständen zumindest anteilig als Werbungskosten absetzen. Dabei lassen sich aber nicht die kompletten Ausgaben geltend machen, sondern nur der Anteil, der dem flächenmäßigen Anteil des Arbeitszimmers an der gesamten Wohnung entspricht.
■ Margarete Lindenblatt
Quelle: n-tv.de, awi
In der Praxis werden Produktentwicklungen und Produktüberarbeitungen häufig aus der Unternehmensperspektive vorgenommen. Wer jedoch sicher gehen möchte, dass die (weiter- entwickelten Produkte die Bedürfnisse des Nutzers befriedigen und infolgedessen verstärkt nachgefragt werden, sollte die Perspektive des Nutzers einnehmen. Hier entfaltet das Design Thinking seine Stärke, denn es ist eine kreative und kollaborative Problemlösungsmethode aus der Nutzerperspektive.
Das Design Thinking wurde von David Kelley, einem Designer aus dem Silicon Valley, entwickelt und ist zudem maßgeblich von der D-School in Stanfort geprägt worden.
In Deutschland wird das Design Thinking insbesondere am Hasso-Plattner-Institut gelehrt und als sechsstufiger Prozess dargestellt. Das Design Thinking ist jedoch nicht nur ein Prozess, sondern ebenso eine Denkweise. Im Arbeitsalltag entfaltet es sein Problemlösungspotenzial insbesondere dann, wenn ganzheitliche und nutzernahe Lösungen gefragt sind. Zudem unterstützt es dabei, eine lebendige Innovationskultur hervorzubringen.
Die sechs Phasen des Design Thinking:
In Phase 1 geht es um das Verstehen. Das wiederum heißt, den Problemraum abzustecken und sich intensiv mit dem gegebenen Thema zu beschäftigen. Dieses könnte beispielsweise ein Megatrend sein, aus dem neue Kundenbedürfnisse entstehen. Diese Phase ist die sogenannte Design Challenge. Sie kann über unterschiedliche Methoden ausgeführt werden, wie beispielsweise über die „semantische Analyse“, das „Steakholdermapping“ oder eine sogenannte „Value-Network-Map“.
Mit den gewonnenen Informationen geht es in Phase 2, das Beobachten. Ziel ist es hierin den Nutzer ganz genau zu verstehen, um Empathie zu ihm aufbauen zu können. Wie bereits in der ersten Phase können dafür unterschiedliche Methoden genutzt werden. Häufig werden in dieser Phase Interviews geführt, z. B. mit potenziellen Nutzern.
Mit den Erkenntnissen der ersten beiden Phasen kann das Problem/Bedürfnis aus der Nutzerperspektive neu definiert werden. Dieses geschieht in Phase 3: Hier wird im Regelfall ein ganz konkreter Nutzer designt, der „Persona“ genannt wird. Die Persona stellt die Eigenschaften und Bedürfnisse des potentiellen Kunden heraus, welche zudem um erhellende Erkenntnisse aus den Interviews erweitert werden.
In Phase 4 sollen maximal viele neue Ideen kreiert werden. Damit das gelingt ist es wichtig, vom Arbeitsalltag loszulassen und das gesamte, möglichst multidisziplinär zusammengesetzte Design Thinking Team einzusetzen. Um Ideen kreieren zu können hilft es, ein bisschen wie ein Kind zu denken. Damit das gelingt werden in dieser Phase spielerische Elemente eingesetzt. Die in Phase 4 entstehenden Ideen werden auf Post-its dargestellt und in der darauffolgenden Phase genutzt.
In Phase 5 wird aus den entwickelten Ideen ein Prototyp erstellt. Hierbei ist es das Ziel, die Lösung möglichst erlebbar für den Nutzer darzustellen. Auch in dieser Phase kommen erneut unterschiedlichste Methoden zum Einsatz, wie beispielsweise das „Moodboard“, mit dem die Stimmung beim Nutzer einfangen werden kann, oder die Visualisierung der Lösung. Das wiederum kann über (i.d.R. kostenfreie) Programme erfolgen, die den Prototypen wie eine App aussehen lassen, oder es werden 3D-Prototypen gebastelt.
Mit den erstellten Prototypen geht es in die nächste Phase, Phase 6, das sogenannte Testen. In dieser Phase wird der Prototyp dem Nutzer vorgestellt und gemeinsam mit ihm getestet. Im Anschluss daran beginnt bereits der nächste Zyklus des Design Thinking, denn aus den in Phase 6 gewonnen Erkenntnissen kann der Prototyp überarbeitet und möglichst genau an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
Die Methode des Design Thinking ist insbesondere in der Start-up-Szene weit verbreitet, in der es häufig darum geht, innerhalb von kürzester Zeit ein an den Bedürfnissen des Nutzers entwickeltes Produkt oder einen Service auf den Markt zu bringen.
Die wichtigste Regel beim Design Thinking ist, konsequent die Nutzerperspektive einzunehmen. Darüber hinaus gilt es stets ohne Grenzen denken zu dürfen. Ein „das geht aber nicht, weil …“ sollte allenfalls vom Nutzer kommen.
Wer diese zwei Regen befolgt, dem stehen mit dem Design Thinking ganz neue Möglichkeiten der Produktgestaltung und -entwicklung offen.
Viel Freude und Erfolg bei den ersten eigenen Schritten und mit dem konsequent aus Nutzerperspektive entwickelten Produkt/Service.
■ Daniel Thiefes
Quellen: https://hpi.de/school-of-design-thinking/design-thinking.html, https://www.youtube.com/watch?v=O6Dl8ri9Lik
Eine Stärke hat Gesundheitsminister Jens Spahn als neues Mitglied der Bundesregierung bereits bewiesen: Kein anderer Minister hat es geschafft, in seiner noch kurzen Amtszeit so viel Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen wie er.
Diese Form ausgeprägter Medienpräsenz allein wird Jens Spahn jedoch nicht reichen: Der Erfolg oder Misserfolg seiner Amtszeit wird daran gemessen, inwieweit er wichtige Änderungen im Gesundheitssystem umsetzt oder wenigstens auf den Weg bringt. An Ideen und Plänen mangelt es dem Minister dabei nicht.
Wie fast immer ist die Umsetzbarkeit an die Finanzierbarkeit geknüpft. Hierfür möchte Spahn die Milliardenrücklagen der gesetzlichen Krankenkassen nutzen. Mehr als die Hälfte der gesetzlichen Krankenkassen sollen dem Gesundheitsministerium zufolge über Reserven verfügen, die über die Höhe einer Monatsausgabe hinausgehen. Insgesamt soll der übersteigende Betrag die beachtliche Summe von 19,2 Milliarden Euro betragen. Nach dem Willen des Gesundheitsministers soll diese Summe ab 2019 schrittweise abgebaut werden – zum Beispiel durch eine erzwungene Senkung des Zusatzbeitrages reicher Krankenkassen.
Die Kassen hingegen argumentieren, sie würden die hohen Rücklagen als notwendiges Polster für die Zukunft – eben schlechtere Zeiten – benötigen. Sie werden ihre Rücklagen also nicht widerstandslos auflösen bzw. abtreten. Nachvollziehbar geben sie zu bedenken, dass die geplanten Änderungen nicht auf einer dauerhaft nachhaltigen Finanzierung aufbauen: Schon jetzt ist absehbar, dass bereits nach wenigen Jahren die vorhandenen Rücklagen verbraucht sein dürften.
Was sehen Jens Spahns Gesetzesentwürfe konkret vor?
◗ Einen Abbau der Krankenkassenüberschüsse: Ab 2019 sollen die Finanzreserven einer Krankenkasse nicht mehr höher sein als eine Monatsausgabe. Kassen mit höheren Rücklagen dürfen ihren Zusatzbeitrag nicht anheben. Überschüsse haben sie innerhalb von drei Jahren abzubauen (z. B. durch Senkung ihres Zusatzbeitrags), sonst geht der Überschuss in den Gesundheitsfonds, wird auf schwächere Kassen verteilt. – Kommt das Gesetz, lassen sich die Zusatzbeiträge der Krankenkassen im Schnitt um 0,3 Prozentpunkte senken.
◗ Die Rückkehr zur Beitragsparität: Ab 2019 sollen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder zu gleichen Teilen am Beitrag (auch dem Zusatzbeitrag) beteiligen, was die Arbeitnehmer um etwa 6,9 Milliarden Euro entlasten soll.
◗ Beitragsentlastung für Selbstständige mit geringem Einkommen durch Herabsetzen des unterstellten Einkommens für den Mindestbeitrag für freiwillige Mitglieder (§240 SGB V). Trotz unverändertem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent soll es dann für ca. 600.000 Selbstständige eine spürbare Reduzierung des Monatsbeitrags auf ca. 179 Euro geben.
◗ Verbesserung der Pflegesituation in den Krankenhäusern und Pflegeheimen: 8.000 Stellen sollen neu geschaffen werden. Die Kosten dieser Pflegestellen sollen die Krankenkassen vollständig tragen. Experten sehen dies skeptisch, bestenfalls als ersten Schritt, denn in der Kranken- und Altenpflege benötigt man deutlich mehr Stellen, um einem Pflegenotstand wirksam zu begegnen. Können die Krankenkassen das dann wirklich allein schultern?
◗ Faire Bezahlung für anspruchsvolle Arbeit: Alle Pflegekräfte müssen Tariflöhne erhalten, damit der Beruf attraktiver wird – sonst werden sich noch mehr junge Menschen für eine andere Berufsausbildung entscheiden.
◗ Vereinheitlichung der Ausbildungsinhalte von Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflegern: schafft mehr Flexibilität und Wechselmöglichkeiten in den unterschiedlichen Berufsfeldern.
◗ Kürzere Termin-Wartezeiten für gesetzlich Versicherte durch Ausbau der von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Terminservicestellen: Im Idealfall ein „Sieben Tage die Woche 24-Stunden-Dienst“ in Verbindung mit einer Erhöhung der Mindestzahl der Sprechstunden für gesetzlich Versicherte auf 25 Wochenstunden.
Auf Kollisionskurs mit den Krankenkassen
Sollten Minister Spahns Gesetzentwürfe verabschiedet und umgesetzt werden, sind dafür in der Tat Jahr für Jahr Milliardenbeträge zu veranschlagen. Solange die deutsche Wirtschaft boomt und die Arbeitslosenquote auf niedrigem Niveau verharrt, kann das funktionieren. Wie diese Mehrkosten aber dauerhaft finanziert werden sollen, wenn die dafür zunächst genutzten Rücklagen der Krankenkassen einmal aufgebraucht sind, bleibt unbeantwortet.
„Kassensterben“ ist nicht auszuschließen
Außerdem befürchten Experten, dass eine (erzwungene) Senkung der Zusatzbeiträge reicher Krankenkassen die Abwanderung von Mitgliedern von Kassen mit hohen Zusatzbeiträgen zu solchen mit niedrigen beschleunigt. Die von dieser Abwanderung betroffenen Kassen müssten dann ihre Zusatzbeiträge weiter erhöhen. Bereits von einer sogenannten „Todesspirale“ ist die Rede, die dadurch in Gang gesetzt würde und zum Kollaps von Krankenkassen mit schlechter finanzieller Situation führen kann. Deshalb fordert der GKV-Spitzenverband weitreichende und umfassende Strukturreformen des Finanzierungssystems mit Weitblick, damit finanzschwache Krankenkassen nicht unnötig in eine Notlage geraten. Zusätzlich stellen die steigenden Gesundheitsausgaben in einer alternden Gesellschaft für die Kassen und politischen Entscheidungsträger ein Problem dar.
Kapitaldeckungsverfahren als Vorbild
Nahezu vorbildlich erscheint vielen Experten in dieser Situation das Kapitaldeckungsverfahren in der privaten Krankenversicherung: Aus im Beitrag einkalkulierten Alterungsrückstellungen bilden die Unternehmen einen Kapitalstock der genutzt wird, um damit die allein durch das Älterwerden steigenden Krankheitskosten möglichst umfassend aufzufangen. Die auf privatrechtlicher Grundlage bestehenden Krankenversicherungsverträge unterliegen nicht dem staatlichen Zugriff. Für die Versicherten ein entscheidender Vorteil: Ihre beachtlichen „Alterungs-Rücklagen“ werden zweckgebunden angespart – das Gesundheitsministerium hat hier keine rechtliche Handhabe, Mittel aus diesem Kapitalstock zur Finanzierung anderer „zweckfremder“ Ausgaben abzuschöpfen.
■ Norbert Schulenkorf
Die Koffer sind gepackt, die Tageszeitung abbestellt, der Nachbar bewegt die Rollläden und gießt die Blumen in der Wohnung. Nichts steht dem wohlverdienten Urlaub mehr im Weg. Doch wer kümmert sich in dieser Zeit um das schmucke Ladenlokal, das leerstehende Büro oder den verwaisten Handwerksbetrieb?
Wie in der Wohnung, erhöht sich auch hier durch längere Abwesenheit das Risiko eines Einbruchdiebstahls. Anders als im eigenen Zuhause ist es in einem Gewerbebetrieb während der Betriebsferien aber nur schwer möglich, Anwesenheit zu simulieren. In den meisten Fällen wird die Abwesenheit sogar aktiv kommuniziert. Da verkünden das Schild in der Eingangstür oder die Nachricht auf dem Anrufbeantworter auch noch den Zeitraum, in dem niemand zu erreichen ist. Kommt jetzt noch eine unzureichende Sicherung des Betriebs hinzu, dann ist jedem Täter der Weg bereitet.
Über 71.200 Einbruchdiebstähle in Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen registrierte die Polizei in 2017 laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS 2017). Die Zahl der Einbruchdiebstähle hat damit im Vergleich zum Vorjahr weiter abgenommen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, aber noch lange kein Anlass, sich hierauf auszuruhen!
Es kann jeden treffen. Und das nicht nur während der Betriebsferien oder in der dunklen Jahreszeit. Beliebte Diebesbeute sind immer wieder Bargeld, Maschinen, hochwertige Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.
Gelegenheit macht Diebe – das gilt auch heute noch. Denn nicht immer sind es Profis oder gezielt agierende Einbrecherbanden. Häufig reicht schon die Aussicht auf schnellen Erfolg. Aus diesem Grund kann man sich – anders als häufig angenommen – sehr wohl gegen Einbrüche schützen.
Sichtbare Sicherungstechnik wirkt eher abschreckend als anziehend. Denn Sicherungstechnik bedeutet längere „Arbeitszeit“ für den Einbrecher und damit ein größeres Entdeckungsrisiko.
Zu diesem Fazit kommt die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der VdS Schadenverhütung GmbH und der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes gemeinsam erstellte Broschüre „Schlechte Geschäfte für Einbrecher“. Dort werden folgende grundlegende Tipps und Empfehlungen ausgesprochen:
◗ Sicherungsmaßnahmen sind immer individuell und müssen auf die jeweilige örtliche Situation abgestimmt werden.
◗ Nutzen Sie frühzeitig das Angebot der Polizei für eine kompetente, kostenlose und neutrale Beratung.
◗ Binden Sie rechtzeitig ihre Versicherung mit ein. Auch deren Anforderungen sind zu berücksichtigen.
◗ Sicherungsmaßnahmen müssen durchdacht sein. Eine Kombination von mechanischer und elektronischer Sicherungstechnik, richtigem Verhalten und organisatorischen Maßnahmen ist ideal.
◗ Pflegen Sie eine gute Nachbarschaft. Was sich beim Schutz vor Wohnungseinbrüchen bewährt hat, gilt auch für den Gewerbebetrieb.
Mit dem richtigen Sicherungskonzept kann man dann also beruhigt auch mal die Arbeit eine Zeit lang ruhen lassen. Erholen Sie sich gut!
■ Karsten Martini
LVM-Leben hilft jungen Menschen bei der Absicherung eines existenziellen Risikos
Rund jeder vierte Deutsche wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Trotzdem gibt es nur in knapp einem Drittel der deutschen Haushalte eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Woran liegt das?
Häufig sind falsche Annahmen ausschlaggebend, nicht selten mangelt es an Informationen, oft ist es aber auch eine Frage des Geldes. Denn wer berufsunfähig ist, wird von seinem Versicherer über Jahre bis Jahrzehnte mit Rentenzahlungen vor dem finanziellen K. o. bewahrt – und das hat einfach seinen Preis. Damit diese so existenzielle Absicherung gleichwohl auch für junge Leute bezahlbar bleibt, geht die LVM ab dem 1. Juli mit einem neuen Angebot an den Markt: der sogenannten LVM-BU- RentePlus mit Startphase. Sie ist insbesondere auch für diejenigen jungen Leute interessant, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen.
Was verbirgt sich hinter der Startphase?
Entscheidet sich ein Kunde für eine LVM-Berufsunfähigkeitsrente mit Startphase, hat das eine besondere Beitragsgestaltung zur Folge: Der Kunde zahlt in den ersten 5 Jahren – bei vollem Schutz – nur 50 Prozent des Beitrags, im sechsten Jahr 60 Prozent, im siebten 70 Prozent … bis dass er ab dem 10. Jahr diese sogenannte Startphase hinter sich lässt und fortan den 100-prozentigen Zielbeitrag entrichtet.
An wen richtet sich das neue Angebot?
In der Ausbildung und im Studium ist das Geld meist besonders knapp, der Berufseinstieg aber auch nicht allzu fern. Deswegen zählen zur Zielgruppe allen voran Azubis und Studierende. Dann wären da noch die Berufseinsteiger, die sich häufig zunächst mit vergleichsweise niedrigen Gehältern durchs Leben schlagen. Und natürlich junge Leute, die mit einer Selbstständigkeit liebäugeln. Schließlich hat ein entsprechender Versicherungsschutz insbesondere für Selbstständige eine existenzielle Bedeutung.
Warum ist eine BU gerade für junge Selbstständige wichtig?
Nur wer in die gesetzlichen Rentenkassen eingezahlt hat, bekommt im Fall einer Erwerbsminderung auch eine Leistung. Selbstständige, die nie pflichtversichert gewesen sind, stehen also ohne jedwede Absicherung da. Aber auch ehemalig oder aktuell Pflichtversicherte haben nur unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf eine Rentenzahlung: Zunächst einmal gilt eine Wartezeit von 5 Jahren, darüber hinaus müssen die Versicherten in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Pflichtbeiträge gezahlt haben.
Hinzu kommt:
Geld vom Staat gibt’s allenfalls in Form einer Erwerbsminderungsrente. Die ist auf jeden Fall zu niedrig, um den Lebensstandard halten zu können. Und: Die volle Erwerbsminderungsrente erhält der Versicherte nur dann, wenn er nicht mehr in der Lage ist, täglich mindestens 3 Stunden lang einer beliebigen Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Bei einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung hingegen liegt der Fokus auf dem Beruf, den der Versicherte zuletzt ausgeübt hat: Sobald er diese konkrete Arbeit nicht mehr zu 50 Prozent verrichten kann, erhält er eine vereinbarte Rentenleistung. Ein Versicherungsschutz, der ab Vertragsschluss gilt – nicht erst nach Ablauf einer Wartezeit. Und der gegebenenfalls sogar im Laufe der Zeit aufgestockt werden kann: Wer beispielsweise die LVM-BU-RentePlus abschließt, darf anlässlich bestimmter Ereignisse die Rente erhöhen – und das ohne eine erneute Gesundheitsprüfung. Hierzu zählen etwa der Abschluss einer Berufsausbildung oder eines Studiums, eine Heirat oder die Geburt eines Kindes.
■ Katharina Fiegl
Outsourcing oder Auslagerung bezeichnet die Abgabe von Unternehmensaufgaben bzw. -Strukturen an externe Dienstleister. Einfacher ausgedrückt: Es geht um Aufgaben, die Spezialisten in genau diesem Sektor besser übernehmen können als man selbst.
Das kann jedoch nicht nur für Unternehmen, sondern auch im Privaten viel Sinn machen. Egal ob für einfache Tätigkeiten – zum Beispiel Fensterputzen – oder komplexere Herausforderungen wie den Vermögensaufbau. Die Frage in beiden Beispielen ist, ob die persönlichen Vorteile gegenüber den Kosten überwiegen.
Weit verbreitet ist die Ansicht, dass „richtig“ Geld anlegen heutzutage doch eigentlich jeder kann. Keine Einzeltitel, sondern eine Mischung aus Aktien- und Rentenfonds, um breiter zu streuen. Eine Fachzeitschrift mit einer Liste der Fonds (oder von Produkten, die einen Index nachbilden), die in den vergangenen Monaten am meisten gebracht haben hilft bei der Auswahl. Das war’s auch schon, oder?
Während die Auswahl des passenden Produktes schon immer aufwändiger war als oben geschildert, funktionierte die genannte einfache Aufteilung auf zwei Anlageklassen durchaus lange Zeit. Denn Aktien und Anleihen erwirtschafteten solide Renditen und entwickelten sich zudem in kritischen Phasen häufig gegensätzlich. Inzwischen ist die Sache jedoch nicht mehr ganz so einfach. Um die mittel- bis langfristigen Anlageziele zu verwirklichen reicht ein derartiges Portfolio womöglich nicht mehr aus. Viele herkömmliche Anlageformen wie Staats- und Unternehmensanleihen gleichen allenfalls noch die Inflation aus.
Erfolgreiche Vermögensanlage heute bedeutet vor allem Risikomanagement. Auch ist es an der Zeit, neue Regionen, Anlageklassen und Marktsegmente in Betracht zu ziehen. Hier sind mehr und mehr Spezialisten gefordert. Aktives Management ist wieder gefragt.
Bei einer Vermögensverwaltung werden – im Gegensatz zur Vermögens- oder Anlageberatung – nicht nur Anlageratschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen auch eigenständig durch den Vermögensverwalter getroffen. Vermögensverwalter optimieren und pflegen die Anlagen im Sinne des Kunden. Das Portfolio besteht hier aus verschiedenen Anlageklassen und geht weit über die Anlage in Einzelfonds hinaus.
Marco Schmitz, Vorsitzender des Anlageausschusses der neuen LVM-Vermögensverwaltung*, nennt einige Elemente: „Zusätzlich zur breiten Diversifikation ist die ständige Risikoüberwachung und ggfs. schnelles Handeln unverzichtbar. In der LVMVermögensverwaltung setzen wir auch auf Multi- Asset-Manager, die ihr Können in unterschiedlichen Marktphasen unter Beweis gestellt haben. Teilweise investieren wir in Anteilsklassen, die sonst für Einzelanleger erst mit Millionenbeträgen erreichbar wären. Wo es Sinn macht, nutzen wir für einen Teil der Investitionen kostengünstige börsengehandelte Fonds (ETF).“
Sie sehen: Die Vermögensverwaltung ist ein Musterbeispiel für Outsourcing im privaten Bereich. Durch die Gebühren erkauft man sich Zeit für andere, schönere Dinge und vertraut dem Know-how der Spezialisten. Obendrein lässt es sich sorgenfreier schlafen. Was könnte lohnenswerter sein?
*Ein Produkt der Augsburger Aktienbank AG
■ Hermann Mangels
Ob eine Wohnung Ziel eines Einbruchs wird, hängt nicht nur vom Standort der Immobilie ab, sondern auch davon, wie leicht Einbrecher sich Zugang zur Wohnung verschaffen können. Fenster und Türen auszutauschen oder nachzurüsten ist deshalb ein wirksames Mittel gegen Wohnungseinbrüche. Wer den Einbruchschutz seiner Wohnung verbessert, kann zinsgünstige Kredite und sogar Zuschüsse von der staatlichen Förderbank KfW erhalten. Bei einer Investition in den Einbruchschutz empfiehlt sich ein Blick auf die Programme der KfW.
Wer in einer Wohnung den Einbruchschutz verbessert oder umgebauten Wohnraum als Erster erwirbt, kann den Kredit KfW 159 beantragen. Je Wohnung finanziert die KfW Vorhaben zum Einbruchschutz bis zu 50.000 Euro.
Alternativ dazu übernimmt die KfW im Zuschuss-Programm KfW 455 einen Teil der Gesamtkosten. Der Zuschuss muss nicht zurück gezahlt werden.
Die KfW fördert sowohl den Austausch alter Bauelemente durch neuere mit besserem Einbruchschutz als auch den Einbau von Nachrüstsystemen. Zu den Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz gehören beispielsweise:
◗ der Einbau einbruchhemmender Haus- und Wohnungseingangstüren,
◗ der Einbau von Nachrüstsystemen für Haus- und Wohnungseingangstüren,
◗ der Einbau von Nachrüstsystemen für Fenster, Balkon- und Terrassentüren sowie einbruchhemmender Gitter und Rollläden,
◗ der Einbau von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen wie Kamerasysteme und intelligente Türschlösser,
◗ der Einbau von Assistenzsystemen wie Gegensprechanlagen, Bewegungsmelder und Notrufsystemen.
Details des Zuschuss- und Kredit-Programms zum Einbruchschutz hat die Förderbank jeweils in eigenen Merkblättern (für Zuschuss und für Kredit) zusammengefasst. Die genauen technischen Anforderungen erläutert die KfW in eigenen Anlagen zum jeweiligen Merkblatt ( für KfW Einbruchschutz Zuschuss und für KfW-Einbruchschutz Kredit).
Die KfW unterstützt mit diesen Programmen Privatleute, unabhängig von deren Alter. Die Antragsteller müssen entweder Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses (mit höchstens zwei Wohneinheiten) sein oder eine umgebaute Immobilie kaufen. Wohnungseigentümergemeinschaften und Mieter können die Zuschüsse ebenfalls in Anspruch nehmen.
Die KfW übernimmt bei den Vorhaben im Rahmen des Programms 455 einen Teil der Kosten. Beim Einbruchschutz sind es 20 Prozent der förderfähigen Kosten für die ersten 1.000 Euro der Investition. Bei Summen darüber hinaus sind es 10 Prozent. Die Kosten müssen mindestens 500 Euro betragen, damit die Förderung gezahlt wird. Die Obergrenze liegt bei 15.000 Euro.
Der Zuschuss für die Maßnahmen zum Einbruchschutz wird direkt bei der KFW beantragt. Die Förderbank hat für diesen und andere Zuschüsse ein eigenes Zuschussportal eingerichtet. Wichtig ist, dass der Antrag gestellt wird, bevor Maßnahmen zum Einbruchschutz begonnen oder ein Kaufvertrag unterschrieben wurde. Sobald der Antrag der KfW vorliegt, wird eine Sofort-Zusage erteilt, oder eine Eingangsbestätigung, auf die dann zeitnah die Vertragsunterlagen folgen. Erst danach sollte mit dem Vorhaben begonnen werden.
Nach Abschluss der Arbeiten wird die Rechnung eingereicht und die Auszahlung beantragt.
Den KfW-Kredit für Maßnahmen zum Einbruchschutz kann jeder Investor von förderfähigen Maßnahmen beantragen, also nicht nur Privatleute, sondern auch Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsgenossenschaften und Körperschaften. Je Wohnung können bis zu 50.000 Euro beantragt werden. Die Programme KfW 159 (Kredit) und KfW 455 (Zuschuss) lassen sich nicht kombinieren.
Da die KfW die Maßnahmen zum Einbruchschutz im Rahmen des Programms „Altersgerecht umbauen“ (Kredit) fördert, gelten die Grundregeln dieses Programms. Der Kredit für Vorhaben zum Einbruchschutz kann nicht direkt bei der KfW gestellt werden, da die Förderbank ihre Kredite nur über Finanzierungspartner vergibt.
Nach Abschluss der Arbeiten muss nachgewiesen werden, dass die technischen Vorgaben umgesetzt und eingehalten wurden. Die KfW hat zum Einbruchschutz eine eigene Fachunternehmerbestätigung.
■ Margarete Lindenblatt
Quelle: Finanztipp
Sie werden sich wahrscheinlich über diese etwas sinnige Überschrift wundern und sich fragen, was ein Heiligenschein mit Mensch und Arbeit zu tun hat.
Auch der Katholikentag, der kürzlich bei uns in Münster stattfand, hat uns nicht so beeinflusst, dass wir jetzt bei jedem Menschen einen Heiligenschein sehen.
Ich spreche vom Halo-Effekt. „Halo“ kommt aus dem Griechischen und bezeichnet den Lichtkreis um Sonne und Mond und bedeutet aus dem Englischen übersetzt Heiligenschein. Der „Halo-Effekt“ bewirkt, dass einzelne positive Eigenschaften einer Person oder einer Sache so stark auf uns wirken, dass andere Eigenschaften damit überstrahlt werden und von uns ausgeblendet werden. Wir schließen also vom Bekannten auf das Unbekannte, ohne dass wir dafür einen entsprechenden Beweis haben.
Eine erstmalige Beobachtung des Halo-Effekts findet sich im Jahr 1907 durch Frederic L. Wells. Den Begriff „Halo-Effekt“ prägte allerdings zu Beginn des 20. Jahrhunderts Edward Lee Thorndike. Ein Ergebnis seiner Forschungen, welches bis heute durch diverse Studien immer wieder belegt werden konnte, besagt, dass der Halo-Effekt am stärksten bei physischer Attraktivität wirkt. Thorndike, der seine Studien u. a. bei der Armee durchführte, beobachtete, dass Soldaten, die als „schön“ oder „attraktiv“ bezeichnet werden konnten, durchweg besser beurteilt wurden, als die anderen Soldaten – und zwar in allen Bereichen.
Einem Menschen, den man als schön empfindet, werden daher aufgrund des Halo-Effekts häufig Attribute wie sympathisch, kompetent, erfolgreich, intelligent und andere ähnlich positive Eigenschaften zugeschrieben. Dass diese Eigenschaften durchweg auf alle schönen Menschen zutreffen, würde keiner ernsthaft behaupten.
Es gibt aber noch viele weitere Beispiele für den Halo-Effekt:
◗ Brillenträger werden als intelligent angesehen.
◗ Sportlerinnen und Sportlern, die in einer bestimmten Sportart gut sind, wird automatisch auch eine gute Sportlichkeit in anderen Sportarten zugeschrieben.
◗ Menschen im Business-Outfit wird ein hohes Selbstbewusstsein unterstellt.
◗ Humorvolle Menschen gelten als vertrauenswürdig.
◗ Attraktive Professorinnen und Professoren werden bei den Studierenden als kompetenter angesehen, als die unattraktiveren.
Sie werden sicherlich selbst noch einige Punkte hinzufügen können.
Auch bei materiellen Dingen ist der Halo-Effekt zu beobachten. Ganze Modelabels sind berühmt geworden, nachdem Hollywoodstars mit deren T-Shirts oder Taschen gesehen wurden.
Der Halo Effekt macht natürlich auch nicht vor der Firmentür halt. Attraktive Bewerber/Bewerberinnen werden dank des Halo-Effekts bei gleicher Qualifikation mit ihren Mitbewerbern/Mitbewerberinnen wahrscheinlich öfter den Arbeitsvertrag in den Händen halten.
Was aber, wenn der Halo-Effekt so strahlt, dass einer Person z. B. gewisse Soft Skills oder fachliche Qualifikationen zugeschrieben werden, die gar nicht vorhanden sind?
Dies ist weder für die Unternehmen noch für die Mitarbeitenden unproblematisch. Falsch eingeschätzte und somit am falschen Arbeitsplatz eingesetzte Mitarbeitende können sich dort nicht entfalten und für das Unternehmen nicht die geforderte und vom Arbeitgeber aufgrund des Halo Effekts auch unbewusst erwartete Leistung bringen. Sie geraten möglicherweise in einen Teufelskreis der Überforderung/Demotivation. Im schlimmsten Fall zieht das hohe Fluktuationszahlen mit den entsprechenden Folgekosten und Auswirkungen auf die Firmenkultur nach sich.
Vermeiden werden wir den Halo-Effekt sicher nicht ganz, da unser Gehirn gerne in Schubladen und Stereotypen denkt, um Energie zu sparen. Wir können aber unser Bewusstsein für das Vorhandensein dieses Effekts schärfen und unsere Einschätzungen öfter mal kritisch hinterfragen und dem „langsamen Denken“ im Gehirn eine Chance geben. Das ist zwar deutlich energieintensiver, kommt dafür aber mit deutlich weniger Stereotypen und Schubladen aus.
Dies gilt nicht nur bei Einstellungsgesprächen, sondern im gesamten beruflichen wie privaten Alltag, ob mit Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden oder in der Familie. Das schnelle, energiearme Denken benutzen wir dann weiter für solche Sachen wie Zähneputzen, den Weg zur Arbeit, den man schon fast blind fahren könnte und weitere fast automatisch ablaufende Tätigkeiten.
Und die Heiligenscheine lassen wir doch einfach bei den Heiligen.
■ Silvia Wiefel
Genau, die Ferien- und Urlaubszeit steht bevor. Nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter – und für manche unbeugsame Narren: Fasching oder Karneval – kann man sie die „sechste“ Jahreszeit nennen.
Ein „Urlaub“ ist von der Wortbedeutung her nicht nur die Gewährung oder selbstständige Ermöglichung der Abwesenheit von primären Alltagspflichten, sondern versteht sich auch als die überwiegend erholungs- oder erlebnisorientierte Reise an sich.
Sprachgeschichtlich geht der Begriff Urlaub auf das alt- und mittelhochdeutsche Substantiv urloup zurück, das zunächst ganz allgemein „Erlaubnis“ bedeutete. In der höfischen Sprache der mittelhochdeutschen Zeit bezeichnete es dann die Erlaubnis wegzugehen, die ein Höherstehender oder eine Dame dem Ritter erteilen konnte. So baten im Hochmittelalter Ritter ihren Lehnsherren um urloub, also um „Urlaub“.
Und heute? Erlauben wir uns – Stichwort Reiseweltmeister – eine Menge Urlaub. Als Reiseweltmeister wird allgemein der Staat bezeichnet, der innerhalb eines Jahres weltweit die höchsten Ausgaben für Auslandsreisen aufbringt. Dabei werden Privat- und Geschäftsreisen berücksichtigt. Bis zum Jahr 2012 wurde jahrelang Deutschland Reiseweltmeister. 2012 sicherte sich dann China erstmals den Titel und Deutschland rutschte auf den dritten Platz ab.
Unterwegs zwischen Fern- und Heimweh?
Urlaubspläne werden also geschmiedet, eine Reise selbst organisiert oder gebucht. Und dann im Urlaub? Unterwegs zwischen der Sehnsucht, vertraute Verhältnisse zu verlassen und mir „die weite Welt“ zu erschließen bzw. der Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat zu sein? Oder bin ich einfach da zu Hause wo ich gerade (im Urlaub) bin?
Früher waren es vor allem die Besonderheiten anderer Kulturen, die unbekannten Speisen, die Düfte, Farben und Riten fremder Länder mit ihren verschiedenartigen Traditionen, die Moden, Tiere und Pflanzen, die sich oft erheblich von denen der eigenen Heimat unterschieden. Heute, im globalen Dorf Welt, sieht die Sache anders aus und auch Kleidungsmoden haben sich längst weltweit angepasst. Man sieht allerorten Mitmenschen aufs Smartphone starren oder in Tablets tippen, welcher Nation sie auch immer angehören.
So gesehen kann ich es ja auch einfach ruhig angehen lassen. Das Ziel ist ausgesucht und dann: Einfach mal gucken. Bietet doch gerade der Urlaub eben auch Zeit für Muße: Tage, Minuten, Stunden spielen eine geringere Rolle als in der alltäglichen Hektik.
Da „urloup“ ganz allgemein „Erlaubnis“ bedeutet, erlaube ich mir diesmal bewusst vorab weniger zu planen – das schafft auf jeden Fall Zeit für Überraschungen!
Was wir Ihnen jetzt wünschen? Einen erlebnisreichen Urlaub Ihrer Wahl und eine gute Zeit natürlich!
■ Karsten van Husen
Wer kennt das nicht: Morgens quält man sich mit dem Auto durch den Berufsverkehr – danach folgt die verzweifelte Parkplatzsuche. Zum Feierabend das gleiche Spiel … womöglich noch tanken – die Zapfsäulen zu Stoßzeiten voll belegt. Das ist purer Stress!
Stress, den man vermeiden kann!
Arbeitnehmer steigen daher immer häufiger auf das Fahrrad um und gelangen oftmals schneller ans Ziel als die autofahrenden Kollegen. Da es inzwischen Elektroräder gibt, werden selbst längere Strecken mühelos gemeistert. Sogar die jüngeren Leute entdecken die Vorteile des „Tretens mit eingebautem Rückenwind“ und verzichten teilweise gänzlich auf ein Auto. Grundsätzlich gilt: Radfahren schont nicht nur den Geldbeutel und trägt zu einer positiveren CO²-Bilanz bei, sondern ist auch gut für die Gesundheit. Bewegung und die Vermeidung von Stress im Berufsverkehr lassen den Tag gleich besser beginnen. Die Arbeitnehmer sind fitter und werden weniger krank.
Nutzen Sie als Unternehmer diese Vorteile für sich.
Denn jeder weiß: Effektiv arbeitende und zufriedene Mitarbeiter sind das A & O eines jeden Unternehmens. Bestärken Sie daher Ihre Mitarbeiter darin. Gehen auch Sie mit gutem Beispiel voran.
Es lohnt sich!
Auch für Sie als Unternehmer ist das Rad oder ein sogenanntes Dienstrad eine gute Alternative oder eine Ergänzung zum Firmenwagen. Neben dem positiven Gesundheitseffekt und dem guten Image bietet ein „Dienstfahrrad“ durchaus auch finanzielle Vorteile. Diese können Sie als Arbeitgeber für sich und Ihre Arbeitnehmer nutzen. Ein Steuerberater kann Ihnen hierzu nähere Informationen geben.
Sie überlegen auf ein Elektrorad umzusatteln und wissen noch nicht, welches Rad zu Ihnen passt? Dann hilft Ihnen der folgende Überblick eventuell, eine Entscheidung zu fällen. Grundsätzlich wird zwischen drei Typen von Elektrofahrrädern (Pedelecs oder E-Bikes) unterschieden:
Typ 1 – Pedelecs bis 25 km/h ohne Anfahrhilfe
Diese „kleinen“ Pedelecs gelten als Fahrräder, da sie trotz 250 Watt Motorleistung nicht mehr als 25 km/h erreichen. Der Elektromotor unterstützt den Radler während des Tretens. Somit gelten für sie auch die gleichen rechtlichen Regelungen wie für Fahrräder. Es besteht keine Versicherungspflicht!
Typ 2 – Pedelecs bis 25 km/h mit einer Anfahrhilfe bis 6 km/h
Diese Pedelecs, welche ohne Mittreten eine Geschwindigkeit von 6 km/h erreichen können, gelten auch als Fahrräder. Sie erreichen ebenfalls trotz Motorleistung eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und unterliegen deshalb den gleichen rechtlichen Regelungen wie der Typ 1.
Typ 3 – Schnelle Pedelecs bis 45 km/h und E-Bikes
Der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen ist schnell erklärt. Schnelle Pedelcs arbeiten mit einem Motor von bis zu 500 Watt und unterstützen den Fahrer bis zu 45 km/h. E-Bikes sind Mofa ähnliche Fahrräder, deren unterstützender Motor bei 25 km/h abregelt. Der Zusatzantrieb unterstützt den Fahrer bis 20 km/h ohne Tretbewegung.
Bei Fahrzeugen vom Typ 3 besteht jeweils eine Versicherungs- und Kennzeichnungspflicht (Mofakennzeichen).
Tipp: Wer einen Schaden durch den Gebrauch seines Fahrrads oder Pedelecs verursacht, haftet für diesen. Daher ist eine Privat- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung unentbehrlich. Bei der LVM sind Pedelecs bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h in der Privat- sowie Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert!
■ Jutta Hülsmeyer
Spätestens seit dem letzten Wahlkampf ist der Begriff „Pflegenotstand“ aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken – und das ist auch gut so, denn die Zahlen und Fakten sind alarmierend.
Zum einen steigt die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland seit Jahren kontinuierlich an. Zur Jahrtausendwende lag dieser Wert noch bei 2,0 Millionen. 2015 mussten bereits 2,9 Millionen Pflegebedürftige versorgt werden – ein Anstieg um 40 Prozent. Glaubt man den Daten des statistischen Bundesamtes, wird dieser Anstieg bis 2030 sogar bei 75 Prozent liegen. 3,6 Millionen Menschen werden dann auf die Hilfe von Pflegekräften angewiesen sein. Das wären sieben Prozent der Bevölkerung, ein doppelt so hoher Anteil wie heute.
Dieser Anstieg dürfte eigentlich niemanden überraschen. Die Menschen erreichen ein immer höheres Lebensalter und die demografische Entwicklung führt zu einem deutlichen Anstieg des Durchschnittsalters in unserer Gesellschaft – eine Entwicklung, die mittlerweile jedes Schulkind kennt: Die Alterspyramide dreht sich auf den Kopf.
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? Wenn sich eine Entwicklung so langfristig ankündigt, könnte man glauben, ein hoch entwickeltes Land wie Deutschland sei in der Lage, die notwendigen Schritte frühzeitig einzuleiten. Aber weit gefehlt. In der Alten- und Krankenpflege sind bundesweit mindestens 36.000 Stellen nicht besetzt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Demnach fehlen derzeit mindestens 26.000 Pfleger sowie etwa 10.000 Hilfskräfte. In ein paar Jahren wird sich diese Situation noch dramatischer darstellen. 300.000 Pflegekräfte werden laut Prognosen des Deutschen Pflegerats bis 2030 fehlen, davon allein 200.000 in der Altenpflege.
Union und SPD versprechen im Koalitionsvertrag ein Sofortprogramm mit 8.000 zusätzlichen Stellen in der Pflege. „Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, warnen jedoch Experten und Oppositionspolitiker. Aber auch wenn es einen Beschluss über 50.000 Stellen gegeben hätte, wie die Grünen fordern, wüsste niemand, woher die Tausende neuen Kranken- und Altenpfleger kommen sollten, denn der Arbeitsmarkt ist leergefegt. In der Altenpflege kommen auf 100 offene Stellen bundesweit lediglich 21 Arbeitssuchende.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Schichtarbeit, Überstunden und geringe Bezahlung sind keine Argumente für eine Ausbildung in der Pflege. Diesen Weg einzuschlagen erfordert eine große Portion an Idealismus und den tiefen Wunsch, Menschen zu helfen. Wenn aber gerade dafür im Arbeitsalltag keine Zeit bleibt, gesellt sich zu der enormen körperlichen auch eine große psychische und emotionale Belastung. Hohe Krankenstände in Pflegeeinrichtungen und die Flucht aus dem Beruf sind die Folge. Die Belastung der verbleibenden Mitarbeiter steigt – ein Teufelskreis.
Diese immer weiter klaffende „Pflegelücke“ wird sich daher nur schließen lassen, wenn der Beruf in der Pflege durch höhere Löhne und verbesserte Arbeitsbedingungen wieder an Attraktivität gewinnt. Verbindliche Vorgaben für Betreuungsschlüssel in Pflegeeinrichtungen wären beispielsweise ein Anfang. Deutschland gehört hier zu den Schlusslichtern. Einer internationalen Pflege Vergleichsstudie aus dem Jahr 2012 zufolge kommen in den USA durchschnittlich 5,3 Patienten auf eine Pflegefachkraft, in den Niederlanden sieben, in Schweden 7,7 und in der Schweiz 7,9. In Deutschland müssen sich Pfleger im Krankenhaus dagegen im Schnitt um 13 Patienten kümmern. Daran wird sich ohne verbindliche Vorgaben nichts ändern, denn für profitorientierte Pflegeeinrichtungen ist die Ausrichtung „Kostenführerschaft“ die sinnvollste Strategie und das Einsparen von Personalkosten ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Dass diese Strategie nicht nur zulasten der Pflegenden, sondern auch der Patienten und Pflegebedürftigen geht, zeigt die Studie einer Forschergruppe um den Gesundheitssystemforscher Prof. Dr. Max Geraedts von der Universität Witten/Herdecke.
Hier wurden zwar explizit nur Pflegeheime miteinander verglichen, aber dass sich die Erkenntnisse grundsätzlich auf den gesamten Pflegesektor übertragen lassen, liegt nahe. Der Studie zufolge bieten profitorientierte Pflegeheime in Deutschland im Vergleich zu nicht-profitorientierten Pflegeheimen insgesamt eine geringere Qualität. Gerade im unteren Preissegment pflegen die profitorientierten Pflegeheime schlechter als die nicht-profitorientierten. Im obersten Preissegment unterscheiden sich die Einrichtungen dagegen kaum noch nach ihrer Profitorientierung. Kurz zusammengefasst heißt das: Gute Pflege ist teuer.
Dass jeder einzelne diese Erkenntnis bei seiner privaten Vorsorge berücksichtigen sollte, um sich im Fall der Fälle eine teurere Pflegeeinrichtung leisten zu können, ist die eine Sache. Aber auch wir als Gesellschaft müssen als Solidargemeinschaft für die Pflege unserer Alten und Kranken einstehen – zumindest finanziell. Das Schließen der Pflegelücke wird viel Geld kosten. Dass Jens Spahn, der seit März Bundesminister für Gesundheit ist, jetzt Beitragssteigerungen für die Pflegeversicherung ankündigt, ist also nur folgerichtig.
■ Ruth Snethkamp
Ob mangelnde Zahlungsmoral von Kunden, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen, Werkverträgen, Liefer- oder Wartungsverträgen, die Gefahr von rechtlichen Auseinandersetzungen für Unternehmen ist stets gegeben. Abhängig vom Umfang des streitigen Gegenstandes können die Kosten für einen Rechtsstreit leicht die Rücklagen des Unternehmens aufbrauchen oder dieses gar finanziell in Bedrängnis bringen.
Viele Jahre war es für die meisten gewerblichen Unternehmen nicht möglich, die finanziellen Folgen eines Rechtsstreites aus schuldrechtlichen Verträgen durch eine Rechtsschutzversicherung abzusichern. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten im gewerblichen Bereich befindet sich auf einem hohen Niveau. Zudem handelt es sich oftmals um hohe Streitwerte, welche wiederum hohe Schadenkosten für die Rechtsschutzversicherer zur Folge haben.
Tatsache ist aber auch, dass sich viele Geschäftskunden zunehmend entsprechende Rechtsschutzprodukte für Vertragsstreitigkeiten von ihrer Versicherung wünschen
LVM-Rechtsschutz bietet seinen Versicherten neben dem bewährten Gewerbe-Kombi-Rechsschutz zusätzlich einen weitgehenden Firmen-Vertragsrechtsschutz, um Streitigkeiten mit Kunden oder Lieferanten vor Gericht jederzeit ganz entspannt entgegen sehen zu können.
Der Versicherungsschutz gilt vor deutschen Gerichten unter anderem bei Streitigkeiten:
◗ aus dem Kauf oder Verkauf von Waren
◗ aus Finanzierungsverträgen
◗ aus Speditions-, Installations- oder Reparaturaufträgen
◗ aus Dienstleistungsverträgen
■ Anne Hilchenbach
Viele kleine und mittlere Unternehmen fahren Dieselfahrzeuge. Aus gutem Grund. Die Fahrzeuge sind sparsamer im Verbrauch und der Treibstoffpreis für Diesel ist durch steuerliche Begünstigung niedriger als für Ottomotoren. Also eigentlich alles richtig gemacht? Aus damaliger Käufersicht ein klares Ja! Als wirtschaftlich denkender Kaufmann und Nutzer von Fahrzeugen mit hohen Fahrleistungen konnte man sich nicht gegen einen Diesel entscheiden.
Inzwischen wird Dieselfahren immer weniger salonfähig. Die Verwendung von unzulässiger Software zur Umgehung von Abgasnormen („Dieselgate“) und die starke Zunahme der Feinstaubbelastung mit drohenden Fahrverboten in einigen Großstädten haben die frühere Attraktivität des Diesel völlig zunichte gemacht.
Bundespolitik und Automobilindustrie waren gefordert und trafen sich als „Nationales Forum Diesel“ mit den Chefs von neun Bundesländern sowie zweimal mit Vertretern der Kommunen, um die drohenden Fahrverbote für Diesel-Pkw zu vermeiden.
Die Ergebnisse: Neben dem Angebot auf Nachrüstung von Diesel-Pkw in den Schadstoffklassen Euro 5 und 6 durch die Fahrzeughersteller wurde der Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ ins Leben gerufen. Dieser will nachhaltige und emissionsfreie Mobilität fördern.
Geplant ist, Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes (Busse, Müllabfuhr) mit modernen Filtersystemen auszustatten und mittels digitalisierter Verkehrsleitsysteme den Autostrom flüssiger durch die Städte zu manövrieren.
Außerdem soll der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge beschleunigt werden. Die Probleme beim Diesel werden damit mittelbar zum Beschleuniger der Elektromobilität.
Noch sind die „Showstopper“ allerdings offensichtlich: Die Anzahl der Ladestationen in Deutschland ist noch nicht flächendeckend. Die Reichweite der Fahrzeuge im reinen Elektrobetrieb ist zu gering. Der hohe Anschaffungspreis wirkt abschreckend, trotz einer staatlichen Förderung in Höhe von 4.000 Euro für den Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs und 3.000 Euro für einen Plug-in Hybrid (Hybrid, bei dem der Akkumulator zusätzlich durch das Stromnetz aufgeladen werden kann).
Das Bestandsziel der Bundesregierung von 1 Million E-Fahrzeugen bis 2020 wird wohl nicht erreicht werden. Allerdings hat der Kauf solcher Fahrzeuge zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen (Bestand am 1. Januar 2018: Elektro-Pkw 53.861 / Hybrid-Pkw 236.710; Vorjahr 34.022 / 165.405).
Als Kaufmann muss man je nach Situation individuell entscheiden, ob es eine sinnvolle Überlegung sein könnte, künftig einen Pkw mit Verbrennungsmotor durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen. Vor- und Nachteile sind abzuwägen, nicht nur beim Anschaffungspreis, sondern auch bei den Folgekosten wie Steuern und Kfz-Versicherung.
Bei der Kfz-Versicherung kann man zum Beispiel einiges falsch machen. Man sollte darauf achten, eine Vollkaskoversicherung abzuschließen, die eine „Allgefahrendeckung“ für den Antriebsakkumulator beinhaltet. Abgesehen von Alterung, Verschleiß und Materialfehlern sind dann alle Ereignisse versichert, denen der Akkumulator ausgesetzt ist. Auch eine Neuwertentschädigung für den Akkumulator (18 Monate bei Totalschaden / 12 Monate bei Entwendung) sollte enthalten sein. Im Fahrzeug unter Verschluss gehaltene mobile Ladestationen sollten ebenfalls mitversichert sein. Wenn diese Kriterien beachtet werden und dann auch der Preis stimmt, hat man bei der Wahl des Versicherungsunternehmens alles richtig gemacht.
■ Rainer Rathmer
Mit dem DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2017 legte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag wieder seine jährliche Einschätzung zur Nachfolgesituation im deutschen Mittelstand vor.
Die Unternehmensnachfolge wird im Mittelstand zu einer immer größeren Herausforderung. Hauptgründe für die zunehmend enge Situation sind dem DIHK zufolge neben der demografischen Entwicklung der Unsicherheitsfaktor Erbschaftssteuer und Finanzierungsschwierigkeiten, trotz derzeit günstiger Konditionen. Nicht zu vernachlässigen sei auch die emotionale Komponente. Gut ein Drittel der Senior-Unternehmer tue sich beim Abschied vom Lebenswerk schwer. Das führe häufig zu überhöhten Kaufpreisen oder dazu, den Nachfolgeprozess auf die „lange Bank“ zu schieben. Zudem unterschätzten fast die Hälfte der Unternehmer die Anforderungen an eine Unternehmensnachfolge.
Das empfehlen die IHKs:
1. „Vorbereitung ist alles“: Etwa drei bis zehn Jahre vor der geplanten Übergabe sollte der Inhaber damit beginnen, sein Unternehmen fit für die nächste Chef-Generation zu machen. Ist das Angebot noch zukunftsorientiert? Stimmen die Margen? Ist die Produktion auf dem neuesten Stand? Muss neu investiert werden? Stimmt die Unternehmensorganisation? Hat das Unternehmen die richtigen Zulieferer und Finanzierungspartner?
2. Nachfolger finden: Spätestens drei Jahre vorher mit der Suche nach einem Übernehmer beginnen.
3. Unternehmen übergeben: Spätestens zwölf Monate vorher den Prozess der Übergabe beginnen.
4. „Stunde Null“:
Nach Übergabe des Unternehmens muss das Spannungsfeld der Interessen von Inhaber, Familie, Nachfolger und Unternehmen gelöst sein. Die Vorkehrungen hierfür sind lange vorher zu treffen (siehe 1.)
Darüber hinaus raten die IHKs einen „Notfallkoffer“ zu packen, in dem alle wichtigen Dokumente und Vollmachten übersichtlich für einen Nachfolger zusammengestellt sind. Diesem Ratschlag sind erst 30 Prozent aller Senior-Unternehmer gefolgt, obwohl ein solches Versäumnis das Unternehmen schnell in Existenzkrisen stürzen kann – wenn etwa bei Krankheit des Eigentümers keine Entscheidungen getroffen werden können und beispielsweise kein Zugang zu Finanzmitteln gewährleistet ist.
■ Anne Hilchenbach
Quelle: Unternehmensnachfolge – die Herausforderung wächst. DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2017,
Stand Dezember 2017
Wenn eine Wohnung am Arbeitsort während der Elternzeit beibehalten wird, so ist dies ausschließlich mit beruflichen Gründen zu rechtfertigen.
Folgender Sachverhalt: Die in einem Krankenhaus beschäftigte Ärztin wohnte und arbeitete in A. Sie unterhielt dort eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Nach der Geburt ihres Kindes zog sie mit ihrem Lebensgefährten zusammen. Der Familienwohnsitz war seit dem in B.
Während der dreijährigen Elternzeit kündigte sie ihre in A. gelegene Wohnung nicht auf. Ihre Planung sah vor, das Beschäftigungsverhältnis in A. nach dem Auslaufen der Elternzeit wieder aufzunehmen. Die Wohnung lag günstig zum Arbeitsort und die Miete war günstig. Außerdem herrschte in A. starker Wohnungsmangel.
Der Auszug aus der bisherigen Wohnung mit späterer neuer Wohnungssuche wäre mit erheblichen finanziellen und organisatorischen Aufwendungen verbunden gewesen.
Die Argumente überzeugten das Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Es berücksichtigte die Aufwendungen als Werbungskosten.
■ Hans-Peter Süßmuth
„Weiblich“, „männlich“ oder etwa „inter/„divers“, diese Auswahlmöglichkeiten werden wir in Zukunft haben, wenn wir unsere Personalien angeben müssen. Bis zum Ende des Jahres 2018 muss der Gesetzgeber eine Neuregelung schaffen, die das dritte Geschlecht berücksichtigt.
Ist es denn wichtig, diesen wenigen Menschen ein Gehör zu verschaffen?
Diese Frage stellen sich Anfang November 2017 viele, denn zu diesem Zeitpunkt verpflichtet das deutsche Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber, bis Ende 2018 einen dritten Geschlechtsbegriff neben männlich und weiblich im Geburtenregister einzuführen.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Anhand dieses Abschnitts aus dem Bundesgesetzbuch können wir uns fragen, ob es würdevoll wäre, wenn wir andere Sexualitäten nicht akzeptieren würden.
Ein bis zwei Menschen von 1000 sind Schätzungen zufolge intersexuell. Sie lassen sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen. Das unterscheidet sie von Transsexuellen, diese fühlen sich dem anderen als ihrem biologischen Geschlecht zugehörig.
Klassische Namen setzen bereits zur Geburt ein Statement. Meist wird den intersexuellen Kindern ein Geschlecht zugeschrieben und die dazugehörige Geschlechtszugehörigkeit auch erwartet. Um nicht aufzufallen und keine Ausgrenzung Gleichaltriger zu riskieren erfolgt eine Anpassung an diese Geschlechterrolle. In den Jahren der Pubertät und der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität werden spätestens Unterschiede zum eigenen und Gemeinsamkeiten zum anderen Geschlecht gefunden. Dann stellt sich meist die Frage:
„Was bin ich eigentlich? Männlich oder weiblich?“ Wer hat uns beigebracht was typisch männlich oder weiblich ist? Woher kommen diese beiden Schubladen, in die wir uns so oft zwängen lassen? In anderen Ländern werden bereits seit Jahren andere Geschlechter berücksichtigt und akzeptiert.
Auf der indonesischen Insel Sulawesi gibt es zum Beispiel fünf anerkannte Geschlechter, die Gesellschaft der Stadt Amarete in Bolivien kennt sogar zehn und im Vereinigten Königreich kann man im Ausweis eine geschlechtsneutrale Anrede beantragen.
Wir sehen also, dass die anerkannte Geschlechteranzahl von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden ist. Es gibt scheinbar kein allgemeingültiges Richtig oder Falsch. Aber wieso konnte sich in Deutschland die Überzeugung festsetzen, dass es nur zwei Geschlechter gibt? Zunächst einmal stiftet die Zuordnung zu einem männlichen oder weiblichen Geschlecht einen für uns logischen Sinn und dient als Vereinfachung, um nicht jeden Tag nach der Sinnhaftigkeit dieser Einteilung zu fragen. Des Weiteren bieten viele wissenschaftliche Ansätze Antworten auf diese Sinnfrage. Der bekannteste Ansatz unter ihnen wird als „doing gender“ bezeichnet.
Die Annahme der geschlechtsspezifischen Rolle wird in dieser Theorie nicht als biologische Tatsache angenommen sondern vielmehr als interaktive Hervorbringung eines Individuums betrachtet. Die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist somit ein entstehendes Ergebnis sozialer Situationen und ein kontinuierlicher Prozess des Erwerbs und der Aneignung von geschlechtsspezifischen Fertigkeiten und Eigenschaften. Die Sprache, die sowohl existierende Dinge beschreibt, bezeichnet und repräsentiert, unterstützt diese Theorie. Sprache kann aber noch mehr, denn sie stiftet in vielerlei Hinsicht Bedeutungen. Sie hat dementsprechend eine produktive Eigenschaft.
„Es ist ein Junge“, diese Worte durch die Hebamme oder einen Arzt setzen also den Startschuss zu einer lebenslangen geschlechtsspezifischen Sozialisation.
Irgendwann wird der Junge in einem Spielzeuggeschäft stehen und sich für eine rosa Glitzerpuppe interessieren. Der Satz der amerikanischen Philosophin Judith Butler fasst diese Situation zusammen:
Natürlich stellt sich die Frage, ob ein einzelnes Gesetz und die Möglichkeit einer Mehrauswahl hinsichtlich der einzutragenden Personalien, dieses Rollendenken ins Wanken bringt. Ein Schritt in Sachen Vielfalt ist es auf jeden Fall. Die Tatsache, dass Vielfalt in jeglicher Hinsicht positiv sein kann, muss sich allerdings noch in unserem Bewusstsein verankern. Wenn Sie möchten, führen Sie doch mal folgendes Gedankenexperiment durch:
Ein Mensch hat ein bestimmtes Problem zu lösen, und er kommt auf drei mögliche Lösungswege. Wie viele verschiedene Ansätze würden wohl zehn Menschen finden, die genauso denken wie dieser eine Mensch? Und wie viele Lösungsansätze würden demgegenüber zehn Menschen finden, die völlig unterschiedlich denken und unterschiedliche Perspektiven einbringen?
Nehmen wir einmal an, dass diverse Menschen gemeinsam mehr Ideen generieren, welche Verschwendung wäre es da, dieses Potential nicht auszuschöpfen und immer nur seine eigene Suppe zu kochen?
Fassen wir einmal zusammen: Wir lösen in der jetzigen Zeit ein angebliches Problem, für welches wir selbst verantwortlich sind. Ein Paradox in jeglicher Hinsicht, für das nun eine erste Lösung durchgesetzt wird, die wir annehmen sollten, um unseren Horizont zu erweitern.
■ Ann-Kathrin Lindemann
Einmal auf Seite Eins der großen Zeitungen stehen – für diesen Traum eines Unternehmens ist eine kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger und notwendiger Schritt. Und das gilt nicht nur für die großen Global Players auf dem Markt.
Auch kleine und mittelständische Unternehmen können mithilfe eines geschickten Umgangs mit Pressevertretern einiges erreichen.
Das eigene Image aktiv zu steuern, ist für ein Unternehmen häufig schwer. Ein guter Kontakt zu Vertretern der öffentlichen Meinung – den Journalisten – bringt dabei allerdings viele Vorteile. Im Gegensatz zum Marketing adressiert die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ihre Texte an Medienvertreter, die diese dann für die breite Masse zugänglich machen.
Die Journalisten sind dabei Multiplikatoren der gezielten Botschaften, die das Unternehmen senden will. Für eine gelingende Partnerschaft der Unternehmens- und Medienvertreter ist ein guter und stetiger Kontakt unerlässlich. Aber wie kann ein Unternehmen diesen Kontakt herstellen und pflegen? Die einfachste Form der Kontaktpflege sind Pressemitteilungen, die das Unternehmen in Richtung der Redaktionen herausschickt. In dieser Mitteilung können neue Produkte, anstehende Ereignisse, Veranstaltungen oder Personalien vorgestellt werden. Allerdings gibt es keine Veröffentlichungspflicht der Mitteilung. Wenn bei der Pressearbeit aber die journalistischen Nachrichtenwerte beachtet werden, ist die Chance auf Veröffentlichung höher:
◗ Aktualität: Ist der Inhalt der Mitteilung neu oder hat sie einen aktuellen Bezug?
◗ Prominenz: Ist eine bekannte Person betroffen?
◗ Nähe: Bezieht sich die Nachricht auf die unmittelbare Umgebung des Unternehmens?
◗ Betroffenheit: Ist etwas Schlimmes passiert?
◗ Tragweite/Reichweite: Wie weitreichend ist der Inhalt der Mitteilung?
◗ Schaden/Nutzen: Schadet oder nutzt die Neuigkeit vielen?
◗ Emotionalität: Regt das Thema der Mitteilung zum Nachdenken an oder bewegt es Menschen?
◗◗ Spannung: Fesselt der Inhalt der Mitteilung?
◗◗ Kuriosität: Klassisches Prinzip „Mann beißt Hund“ anstelle von „Hund beißt Mann“.
Bei größeren Neuerungen oder Themen mit besonderer Relevanz für die Öffentlichkeit eignet sich zusätzlich zu einer Mitteilung eine Pressekonferenz, zu der verschiedene Journalisten eingeladen werden. Zuerst stellen einige Unternehmensvertreter in kleinen Einführungsstatements die Neuerungen vor oder informieren über bestimmte Themen. Im Anschluss dürfen die Medienvertreter Fragen stellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in einem Hintergrundgespräch einem vertrauten Journalisten Informationen bereitzustellen, die nur nach Absprache verwendet werden dürfen.
In Vor-Ort-Terminen bieten Pressegespräche einen persönlicheren Rahmen für die eingeladenen Journalisten. Dort können sie aktiv Fragen stellen. Die Journalisten werden dabei mehr in den Kommunikationsprozess eingebunden als bei Pressekonferenzen. Aber Achtung: Der Anlass muss ein Vor-Ort-Gespräch rechtfertigen. Das Gegenstück dazu ist der Redaktionsbesuch. Die Vertreter des Unternehmens besuchen Journalisten nach Absprache an ihrem Arbeitsplatz. Dabei geht es eher um einen informativen Austausch und die Kontaktpflege.
Positiv für die Außendarstellung des Unternehmens ist die zusätzliche Positionierung der eigenen Mitarbeiter als Experten auf ihrem Gebiet. Neben den Führungskräften, die häufiger in Pressemitteilungen oder -terminen zu Wort kommen, können die Mitarbeiter einer Abteilung dem Journalisten nähere Informationen zu bestimmten Themengebieten geben. Hilfreich wäre es deshalb, eigene Mitarbeiter als Experten für Interviews oder als Ansprechpartner für andere Formate zur Verfügung zu stellen.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet viele Facetten, um mit Journalisten in Kontakt zu treten. Nur wenn der Kontakt auch gepflegt wird, kann ein dauerhaft gutes Verhältnis zwischen Medien- und Unternehmensvertretern entstehen. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen bietet es sich also an, die regionalen Medien kontinuierlich anzusprechen und mit Informationen zu versorgen.
■ Henrika Huil
Sind Sie Händler oder Handwerker und verkaufen Waren? Dann sollten Sie unbedingt weiterlesen …
… denn seit dem 1. Januar 2018 hat sich die Gesetzeslage geändert. Die Haftung für Sie als Händler oder Handwerker hat sich damit nochmals verschärft. Damit der Erfolg und die Existenz Ihres Unternehmens nicht gefährdet werden, ist besonderer Versicherungsschutz gefragt.
Wie war es bisher?
Händler und Handwerker haften – im Rahmen des Gewährleistungsrechts – ohne eigenes Verschulden für Mängel an der verkauften Ware. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahre 2011 (C 65/09) verschärfte nochmals die Haftung und erweiterte den Anspruch des „privaten Käufers“ einer beweglichen Sache auf „Aus- und Einbaukosten“. Dieses Urteil bezog sich nur auf den sogenannten „Verbrauchsgüterkauf “.
Der Verbrauchsgüterkauf ist der Verkauf einer beweglichen Sache von einem Unternehmer an den Privatkäufer als Endverbraucher. Oftmals wird auch der Begriff B2C-Geschäft verwendet (B2C = Business to Custumer – Unternehmer zu Privatkunde). Bewegliche Sachen sind Gegenstände, die von einem Ort zum anderen gebracht werden können, also mobil sind.
Ein Beispiel hierzu: Der „Fliesen-Fall“
Ein Kunde kaufte in einem Baumarkt Bodenfliesen eines italienischen Herstellers. Die polierten Fliesen ließ er durch eine Fachfirma verlegen. Kurz nach Abschluss der Arbeiten stellte der Kunde einen Grauschleier auf den Fliesenoberflächen fest, der auf produktionsbedingte Mikroschleifspuren zurückzuführen war.
Der Kunde verlangte vom Baumarktbesitzer den Ersatz der Fliesen und zusätzlich die „Kosten für den Ausbau der schadhaften Fliesen und die Neuverlegung“. Die Richter sprachen dem Kunden eine angemessene Entschädigung für die angefallenen Aus- und Einbaukosten zu.
Was hat sich geändert?
Neue Gesetzeslage ab 1. Januar 2018 (§ 439 Abs. 3 BGB neue Fassung): Die Austauschpflicht – in dem o.g. Fall also der Ausbau der schadhaften Fliesen und die Neuverlegung – besteht jetzt unabhängig davon, ob der Käufer privater oder gewerblicher Abnehmer ist. Damit erhöht sich für Sie als Unternehmer nochmals das Risiko. Denn Sie haften nicht nur bei dem Verkauf an den Privatkunden, sondern jetzt auch bei dem Verkauf an andere Unternehmer bzw. gewerbliche Abnehmer. Häufig wird auch der Begriff B2BGeschäft verwendet (Business to Business – Unternehmer zu Unternehmer).
Wie können Sie sich absichern?
Besonderer Versicherungsschutz für den Ersatz der Aus- und Einbaukosten ist gefragt! Dieser ist üblicherweise nicht in der Betriebshaftpflichtversicherung enthalten. Die Erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung deckt diese Kosten ab – ein unverzichtbarer Zusatzschutz für Händler und Handwerker.
■ Jutta Hülsmeyer
Werden betrieblich genutzte Räume in die häusliche Sphäre eingebunden, so sind sie nur dann als Betriebsstätte anzuerkennen, wenn sie nach außen erkennbar für einen intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr vorgesehen sind. So entschieden vom Bundesfinanzhof.
Im vorliegenden Fall hatte ein Versicherungsmakler für seine Tätigkeit im Obergeschoss des Hauses seiner Tochter, in welchem er auch wohnte, einen Büroraum mit davor liegendem Flurbereich und einer Gästetoilette angemietet. Die darauf entfallenden Aufwendungen machte er in voller Höhe als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt qualifizierte die Räume als häusliches Arbeitszimmer und lehnte den Betriebsausgabenabzug ab.
Das Gericht folgte der Auffassung des Finanzamtes. Bei der Eingliederung der betrieblich genutzten Räume in den Wohnbereich fehle es an der nach außen gerichteten Widmung für den Publikumsverkehr.
■ Hans-Peter Süßmuth
Pflegende Angehörige sind extrem belastet. Noch relativ unbekannt ist, dass bereits zum 1. Januar 2015 ein Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf in Kraft getreten ist, mit dem die bestehenden Regelungen im Pflegezeitgesetz und im Familienpflegezeitgesetz weiter entwickelt und besser miteinander verzahnt wurden. Im Ergebnis eröffnen sich dadurch notwendige Freiräume, die Pflegende dringend benötigen: Zum Beispiel die teilweise Freistellung für die häusliche Pflege naher Angehöriger. Damit wird Arbeitnehmern ermöglicht, über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren Pflege und Beruf besser miteinander zu vereinbaren.
Seit dem 1. Januar 2015 haben Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit. Dadurch können sie eine (teilweise) Freistellung für die häusliche Pflege von nahen Angehörigen von bis zu 24 Monaten bei einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 15 Stunden beanspruchen. Haben sie zunächst eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für einen kürzeren Zeitraum beantragt, lässt sich der Zeitraum der Freistellung mit Zustimmung des Arbeitgebers bis zur Höchstdauer von 24 Monaten verlängern. Wenn ein vorgesehener Wechsel/Austausch der Pflegeperson aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann, haben Beschäftigte gegenüber ihrem Arbeitgeber sogar einen Anspruch auf die Verlängerung der Familienpflegezeit.
Auch um minderjährige pflegebedürftige nahe Angehörige im eigenen Zuhause oder im außerhäuslichem Umfeld betreuen zu können bietet das Familienpflegezeitgesetz den Beschäftigten die Möglichkeit der Freistellung: Entweder die teilweise Freistellung bis zu 24 Monaten bei einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 15 Stunden oder (nach dem Pflegezeitgesetz) eine vollständige oder teilweise Freistellung bis zu sechs Monaten. Dies gilt übrigens auch für die Begleitung von nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase.
Generell gilt: Auch bei Kombination der verschiedenen Freistellungsansprüche aus beiden Gesetzen beträgt die Dauer der Arbeitszeitreduzierung maximal 24 Monate.
Ausnahmeregelung zum Schutz kleinerer Unternehmen
Kleinere Unternehmen können den durch die Arbeitszeitreduzierung bedingten Teil-Ausfall von Beschäftigten oft nur schlecht kompensieren. Deshalb gilt der Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung nach dem Familienpflegezeitgesetz nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger Beschäftigten (Auszubildende zählen hier nicht mit).
Kompensation des Lohnausfalls durch zinsloses Darlehen
Zum Ausgleich des Lohnausfalls bei Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz können Beschäftigte ein zinsloses staatliches Darlehen erhalten. Über Einzelheiten informiert das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Dort ist es auch zu beantragen.
Ausweitung des Personenkreises „nahe Angehörige“
Mit Inkrafttreten des Gesetzes wurde auch der unter den Begriff „nahe Angehörige“ gefasste Personenkreis erweitert. Partner in einer lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft sowie Stiefeltern und Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner gehören seither dazu.
„Frei“-Zeit für Angehörige, die eine akut aufgetretene Pflegesituation organisieren
Angehörige können sich bis zu zehn Arbeitstage von der Arbeit freistellen lassen und dafür einen Lohnersatz, das Pflegeunterstützungsgeld, beanspruchen.
Pflegeberatung der Pflegekassen unbedingt nutzen!
In jedem Fall ist es ratsam, sich von Pflegeberatern der Pflegekasse individuell beraten zu lassen. Diese Pflegeberatung kann auch vor Ort in der häuslichen Umgebung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen erfolgen. Dabei wird das gesamte Spektrum möglicher Leistungen und anderer Hilfen (wie z. B. Tages-, Kurzzeit oder Verhinderungspflege) angesprochen.
Wichtig: Private zusätzliche Vorsorge bleibt notwendig
Die verbesserte Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist ein wichtiger Schritt. Allerdings ändert er nichts daran, dass Pflege teuer und ihre Finanzierung nicht gesichert ist. Auch das Gesundheitsministerium empfiehlt deshalb eine private Zusatzversicherung zur Vorsorge im Pflegefall. Die private Vorsorge sorgt Tag für Tag zumindest für eine finanzielle Entlastung. Denn die staatliche Pflegepflichtversicherung deckt nur etwa die Hälfte der Kosten.
Verantwortungsbewusste Menschen, die ihr Pflegekostenrisiko und das ihrer Angehörigen spürbar reduzieren möchten, sollten frühzeitig handeln. Denn je früher die Entscheidung für einen Pflege-Tagegeldtarif fällt, umso günstiger sind dafür die monatlichen Beiträge. Das rechnet sich sogar dauerhaft.
■ Norbert Schulenkorf
2014 wurde von der EU eine Richtlinie zur Erweiterung der Berichterstattung von großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Versicherungsunternehmen verabschiedet, die sogenannte CSR-Richtlinie. Ziel der Richtlinie ist es, die Transparenz über ökologische und soziale Aspekte von Unternehmen in der EU zu erhöhen. 2017 wurde diese Richtlinie in deutsches Recht übertragen. Sie verpflichtet die betroffenen Unternehmen, einmal jährlich eine sogenannte „nicht-finanzielle Erklärung“ zu veröffentlichen. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind von dieser Berichtspflicht zwar nicht direkt betroffen, sollten aber ihre Chancen nutzen, den Nachhaltigkeitspfad bewusst einzuschlagen, um Wettbewerbsvorteile zu generieren.
Chancen einer Nachhaltigkeitsstrategie für KMU:
Im B2C-Bereich sprechen die Studien eine eindeutige Sprache. Das Interesse an Nachhaltigkeit steigt bei den deutschen Konsumenten von Jahr zu Jahr. Rund 79 Prozent der deutschen Bevölkerung setzen sich laut der 2016 erschienen Sustainability Image Score-Studie von Facit Research mit dem Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich auseinander. Gut ein Drittel der Studienteilnehmer tut dies sogar intensiv – vier Prozent mehr als noch drei Jahre zuvor.
In einer 2017 von digital research veröffentlichten Studie formulierten 81 Prozent der Teilnehmer sogar eine klare Erwartungshaltung in Richtung der Unternehmen, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Durch die steigende Transparenz im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichtspflicht wird sich diese Erwartungshaltung in Zukunft vermutlich noch verstärken.
Obwohl KMU nicht der neuen Berichtspflicht unterliegen, werden die Auswirkungen mittelbarauch für sie spürbar werden. Denn die Richtlinie verlangt von den betroffenen Unternehmen Transparenz über die Nachhaltigkeit der gesamten Lieferkette und damit auch über die Nachhaltigkeitsbemühungen zuliefernder Unternehmen. Ein transparentes Nachhaltigkeitsmanagement kann sich daher auch im B2B-Bereich für kleine und mittlere Zulieferbetriebe zu einem echten Wettbewerbsvorteil entwickeln.
Auch im zunehmenden Wettbewerb um junge Fachkräfte zahlt sich eine nachhaltige Unternehmensführung und Personalpolitik aus. Gerade Berufsstarter wollen sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können. Dass Unternehmen, die dieses Bedürfnis bedienen, zufriedenere Mitarbeiter haben und leichter Talente anwerben können, zeigt eine Studie des Instituts für berufliche Bildung und Arbeitslehre der TU Berlin.
Insgesamt lässt sich festhalten: Eine nachhaltige Unternehmensausrichtung zahlt positiv auf das Image und die Reputation eines Unternehmens, seine Wettbewerbsfähigkeit sowie seine Kunden- und Mitarbeiterbindung ein.
Stärken von KMU bei der Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie:
Gerade KMU sollten darüber nachdenken, eine klare Nachhaltigkeitsstrategie für das eigene Geschäftsmodell zu entwickeln und diese kommunikativ zu nutzen.
Denn KMU haben eine natürliche strukturelle Nähe zu nachhaltiger Unternehmensführung und sind in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht häufig bereits gut aufgestellt.
Insbesondere Familienunternehmen haben meist einen langfristigeren Blick auf ihre ökonomische Entwicklung als manch managementgeführtes Großunternehmen. Denn sie haben bei der Ressourcenplanung die Perspektive der nachfolgenden Generation im Fokus – und eben nicht kurzfristige Gewinnziele zur Befriedigung von Aktionärsinteressen.
Schon aus eigenem Interesse leisten KMU häufig durch soziales Engagement, Förderung von Sport, Kultur und Bildung einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl und zur Stärkung der Region, denn sie sind dort fest verwurzelt und auf die Infrastruktur sowie das Funktionieren der gesellschaftlichen Strukturen vor Ort angewiesen.
Vorteile ergeben sich zudem aus den oft schlanken Strukturen. Eine überschaubare Größe und Komplexität sowie eine enge Beziehung zwischen Geschäftsführung und Eigentümer – häufig sogar in Personalunion – ermöglichen es, flexibel zu handeln und Maßnahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie schnell umzusetzen.
Die wichtigsten Fragen auf dem Weg zu einer Nachhaltigkeitsstrategie
Wer die Vorteile einer nachhaltigen Ausrichtung bewusst für sein Unternehmen nutzen möchte, sollte sich zuvor einige Fragen beantworten:
1.) Wofür soll das Unternehmen stehen? Eine Mission und ein konkretes Ziel sind die Basis einer erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie.
2.) Was sind die Stärken und Schwächen des Unternehmens? Nachhaltigkeitsmaßnahmen sollten zum Unternehmen passen und eine natürliche Verbindung zum Geschäftsmodell haben.
3.) Was erwarten die Kunden vom Unternehmen? Die Vorstellungen von Kunden und anderen Stakeholdern sollten unbedingt berücksichtigt werden.
4.) Wie kann ich mein Ziel messen und welche Zwischenziele erscheinen greifbar? Zwischenziele helfen die eigene Motivation und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht zu erhalten. Diese Ziele und Zwischenziele sollten regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden.
Entscheidend für das Heben von Wettbewerbsvorteilen ist aber am Ende, Erfolge auch zu kommunizieren. Denn das Motto muss lauten: Tue Gutes und rede darüber.
Wichtige Meilensteine der Nachhaltigkeitsdiskussion und CSR-Berichtspflicht:
1713
Hans Carl von Carlowitz formuliert angesichts einer drohenden Holzknappheit erstmals, dass immer nur so viele Bäume geschlagen werden sollten, wie durch Aufforstung nachwachsen konnten und forderte eine „nachhaltende“ Nutzung des Waldes.
1972
Der erste Bericht des Club of Rome unter dem Titel „Grenzen des Wachstums“ zeigt die Endlichkeit natürlicher Ressourcen auf.
1980
Die „World Commission of Environment and Development“ (WCED) wird gegründet und setzt die Brundtland-Kommission ein.
1987
Der sog. Brundtland-Bericht unter dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“ wird veröffentlicht und definiert Nachhaltigkeit neu als „Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“.
1992
Die Weltkonferenz in Rio de Janeiro leitet den „Rio-Prozess“ ein. Die Agenda 21 und verschiedene Konventionen zu Umwelt- und Entwicklungsfragen werden beschlossen.
1997
Die UN-Klimakonferenz verabschiedet das Kyoto-Protokoll.
2002
Der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg verabschiedet neue Ziele und die Bundesrepublik Deutschland legt ihre erste Nachhaltigkeitsstrategie vor.
2014
Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten der EU verabschieden die sog. CSR-Richtlinie zur Erweiterung der Berichterstattung von großen kapitalmarktorientierten Unternehmen.
2017
Deutschland setzt die Richtlinie in nationales Recht um (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz).
■ Ruth Snethkamp
Von Berlin nach München in 30 Minuten? Schon in wenigen Jahren soll das möglich sein: Mit der Hyperloop-Technologie. Um die 600 Kilometer in einer halben Stunde zu bewältigen, müssten sich die Transportkapseln mit 1200 Kilometern in der Stunde durch eine Vakuum-Röhre bewegen. An diesem kühnen Vorhaben feilen Unternehmen auf der ganzen Welt.
Der Hyperloop ist das Konzept eines Hochgeschwindigkeitstransportsystems, wobei eine Magnetschwebebahn in einer Röhre mit Unterdruck befördert wird. Der Hyperloop ähnelt dem Transrapid, nur dass bei diesem keine evakuierten Röhren verwendet werden. Es sollen nach dem Konzept der Rohrpost durch Solarenergie elektrisch getriebene Transportkapseln mit Reisegeschwindigkeiten von bis zu etwa 1125 km/h auf Luftkissen durch eine teilevakuierte Röhre befördert werden.
Die Firma Hyperloop One veröffentlichte im Juni 2017 unter dem Titel Vision for Europe insgesamt neun Konzepte für potentielle Hyperloopstrecken in Mittel- und Westeuropa.
Die längste der projektierten Routen sieht einen kreisförmigen Streckenverlauf vor, der die Städte Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Hamburg miteinander verbinden soll. Der Hyperloop soll die 1991 km lange Strecke in 142 Minuten befahren, wobei die voraussichtliche Fahrtzeit für Berlin-Leipzig mit 14 min, Leipzig-Nürnberg mit 20 min, Nürnberg-München mit 12 min, München-Stuttgart mit 17 min, Stuttgart-Frankfurt mit 15 min, Frankfurt-Köln mit 14 min, Köln-Hamburg mit 30 min und Hamburg-Berlin mit 20 min angegeben wird.
Die Geschichte:
Der Unternehmer Elon Musk (s.a Tesla & Space X) stellte das Konzept im August 2013 vor. Damit ist es laut Musk möglich, auf Strecken von bis zu 1500 Kilometern deutlich schneller und umweltfreundlicher als mit dem Flugzeug und gleichzeitig deutlich günstiger als mit der Bahn zu reisen.
Die Technik:
Laut dem Konzept sollen auf Stahlbetonstützen zwei nebeneinander liegende Fahrröhren aus Stahl, in denen ein Teilvakuum herrscht, gebaut werden. Darin sollen Kapseln bewegt werden, in denen jeweils bis zu 28 Passagiere Platz finden oder die in einer größeren Variante auch Autos oder andere Lasten transportieren können. Sie sollen reibungsarm auf Luftpolstern gleiten, die durch einen Kompressor mit vor den Fahrzeugen abgesaugter Luft erzeugt werden. Die meisten Unternehmen und Forschungseinrichtungen planen mittlerweile aber ein elektromagnetisches Schwebesystem. Das Teilvakuum ermöglicht Reisegeschwindigkeiten bis knapp oberhalb der bei Normaldruck bestehenden Schallgeschwindigkeit, ohne die Schallmauer durchstoßen zu müssen.
Der Stand der Dinge:
1200 Kilometer in der Stunde sind das Ziel des Hyperloop. Jetzt hat das neue Transportsystem eine Rekordmarke geknackt – ist aber immer noch weit vom Ziel entfernt.
Mit Geschwindigkeiten jenseits der 300 ist der Hyperloop auf Teststrecken aber immer noch nicht schneller als es die schnellsten Züge der Welt sind. Den Rekord hält bislang die japanische Magnetschwebebahn Maglev, die 600 km/h im Testbetrieb schaffte. Sie soll von 2027 an die Hauptstadt Tokio mit Nagoya verbinden, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 500 Kilometer pro Stunde. Auch der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV schaffte auf der Neubaustrecke zwischen Metz und Paris schon einmal 570 km/h. Elon Musk’s Firma Boring hat eine vorläufige Genehmigung für einen Hyperloop zwischen New York und Washington DC erhalten. Über einen Tunnel soll die Fahrt zwischen den beiden Städten von über drei Stunden auf 29 Minuten reduziert werden. Nach Medienberichten darf Musk mit Ausgrabungen in der New York Avenue in Washington beginnen. Bereits im Juli hatte Musk getwittert, dass er die verbale Zustimmung der Regierung erhalten hatte, einen unterirdischen Hyperloop an der Ostküste zu bauen. Und auch der britische Unternehmer und Philanthrop Richard Branson enthüllte Hyperloop-Pläne. Er will die indischen Städte Mumbai und Pune verbinden.
Was bleibt uns Fahrgästen:
Entspanntes Abwarten – besonders im täglichen Berufsverkehr!
■ Karsten van Husen
Bei kaum einem Thema wird so kontrovers gehandelt wie beim Thema Datenweitergabe. Millionen von Nutzern moderner Kommunikationsmedien geben arglos oder willentlich sensible Daten preis. Andererseits steigen bei den Nutzern die Erwartungen an den Schutz personenbezogener Daten.
Wenn man an das Sammeln von Daten denkt, hat man in erster Linie das Internet bzw. internetbasierte Anwendungen wie Facebook, Twitter, WhatsApp oder Cloud-Anwendungen im Sinn.
Eine offensichtliche Datenquelle wird bisher übersehen: Das Automobil. Durch die ständige Weiterentwicklung und Vernetzung unserer Autos werden sie zu immer größeren Datenlieferanten.
Und auf diese Datenquelle hat bisher allein einer Zugriff: Der jeweilige Hersteller des Fahrzeugs.
Ist das richtig so? Wem gehören eigentlich die beim Fahrzeugbetrieb anfallenden Daten? Dem Fahrzeughersteller? Dem Halter oder Fahrer des Fahrzeugs? Vielleicht beiden? Was ist, wenn es sich um ein Leasingfahrzeug handelt? Gehören die Daten dann dem Leasinggeber, also dem Fahrzeugeigentümer oder dem Kfz-Halter, der es für gewöhnlich nutzt? Gibt es rechtlich überhaupt ein „Eigentum“ an Daten?
Das sind Fragen, die auch das Bundesverkehrsministerium interessieren und die so schwer zu beantworten sind, dass es dazu die Studie „Eigentumsordnung an Mobilitätsdaten?“ in Auftrag gegeben hatte. Im Sommer 2017 wurde die Studie veröffentlicht und befindet sich zurzeit in einer breiten Fachkonsultation, die sich an sämtliche Interessenträger u.a. aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Instituten und Verbraucherschutzorganisationen richtet. Die Klärung der Eigentumsfrage ist Basis für die Erschließung neuer Geschäftsmodelle. Die Diskussion dazu dauert aktuell noch an.
Einigkeit besteht darüber, dass Daten marktfähige und damit finanziell relevante Güter sind. Ebenfalls klar zu sein scheint, dass Datenmonopole vermieden werden müssen. Aus diesem Grunde müssen Mobilitätsdaten Gegenstand einer regulatorischen gesetzgeberischen Initiative sein.
Ein Ausschnitt zu diesem Thema – die Speicherung von Daten in Kfz mit hochautomatisierten Systemen – wurde im Januar auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar diskutiert. Die dort vertretenen Experten empfahlen, solche Daten nicht nur im Kfz selbst („black box“), sondern auch außerhalb bei „einem unabhängigen Dritten“ zu speichern.
Damit ist die richtige Zielrichtung vorgegeben. Nicht nur die Autohersteller, sondern Dritte müssen einen Datenzugriff haben können. Die Autofahrer selbst müssen frei entscheiden können, ob, wann und wem sie welche Daten senden. Dadurch werden dann ganz praktische Fragen beantwortet: Die Unfallmeldung aus dem Fahrzeug geht sofort an die Notrufzentrale. Wohin geht sie noch? An den Autohersteller? Oder besser gleich an den Versicherer, damit dieser die Bergung des Fahrzeugs und die schnellstmögliche Schadensregulierung veranlassen kann?
Die Frage nach der Hoheit über solche Daten ist aktuell auch Gegenstand der Petition „data4drivers“, die sich klar positioniert: Die im Auto anfallenden Daten gehören nicht den Automobilherstellern, sondern in die Hände der Autofahrer.
WER SOLL DIE HOHEIT ÜBER IHRE DATEN HABEN? ENTSCHEIDEN SIE SELBST: WWW.DATA4DRIVERS.EU ■ Rainer Rathmer