Text: Annika Hohoff
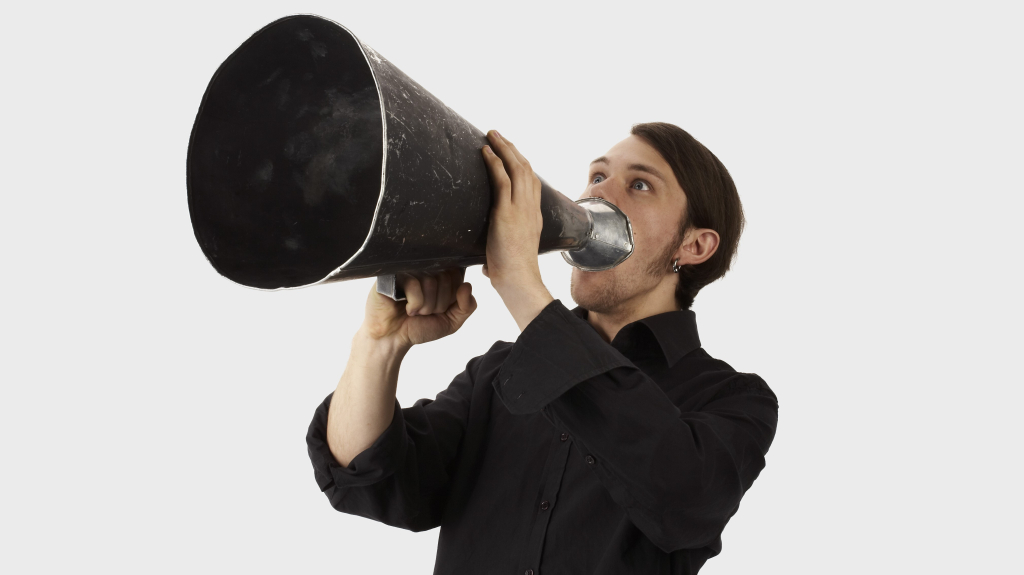
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich arbeitsplatztypische Hintergrundgeräusche auf die Konzentration und die kognitiven Leistungen von Beschäftigten auswirken. Ziel war es, herauszufinden, ob die Leistungsminderung objektiv messbar ist oder ob sie eher auf subjektiven Wahrnehmungen der Personen beruht.
Durchführung der Studie
Die Studie wurde in einem schallgedämmten Labor mit rund 70 Teilnehmern durchgeführt. Diese hatten Leseaufgaben unter vier Bedingungen zu bearbeiten: In völliger Ruhe und unter drei verschiedenen Hintergrundgeräuschen. Diese Geräusche waren Aufnahmen von einem Kassenarbeitsplatz im Textileinzelhandel, einem Büro und einer Baustelle. Die Aufgaben bestanden aus kurzen Texten und Sätzen, die auf Fehler zu überprüfen waren.
Es wurde untersucht, ob sich die Störgeräusche negativ auf die Qualität der Bearbeitung der Leseaufgabe auswirken und ob sich die Ergebnisse je nach Art der Geräusche unterscheiden. Zudem sollten die subjektiven Einschätzungen der Teilnehmer ermittelt werden. Die Probanden wurden dazu nach ihrer Einschätzung befragt, ob sie Einschränkungen in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit wahrnehmen konnten und wenn ja, unter welchen Geräuschbedingungen.
Ergebnisse
Die Anzahl korrekt bearbeiteter Aufgaben war bei Geräuschbedingungen geringer als bei Ruhebedingungen. Dies zeigt, dass Hintergrundgeräusche die kognitive Leistung negativ beeinflussen. Der deutlichste negative Effekt wurde bei Geräuschen aus dem Textileinzelhandel festgestellt, gefolgt von Bürogeräuschen. Baustellengeräusche, obwohl am lautesten, zeigten keinen signifikanten Einfluss auf die Leistung. Die subjektiv wahrgenommenen Konzentrationsdefizite waren insgesamt größer als die objektiv gemessenen Leistungseinbußen. Die Teilnehmer empfanden dabei einen stärkeren Einfluss auf die Konzentration unter Baustellenlärm als bei der Bearbeitung der Aufgaben unter den anderen beiden Geräuschkulissen.
Handlungsempfehlungen
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung von Lärm am Arbeitsplatz. Um störende Geräusche zu identifizieren und deren Auswirkungen einzuschätzen, können Arbeitgeber Befragungen der Beschäftigten durchführen. Basierend auf den Befragungsergebnissen ist es möglich, gezielte Maßnahmen zur Lärmminderung zu entwickeln und umzusetzen. Eine schallgedämmte Arbeitsumgebung und die Reduktion von störenden Geräuschen, insbesondere solchen, die Sprache enthalten, können die kognitive Leistungsfähigkeit der Beschäftigten verbessern.

Zur Autorin:
Annika Hohoff ist Wirtschaftsmathematikerin und erstellt bei ihrem Arbeitgeber versicherungsmathematische Gutachten.
